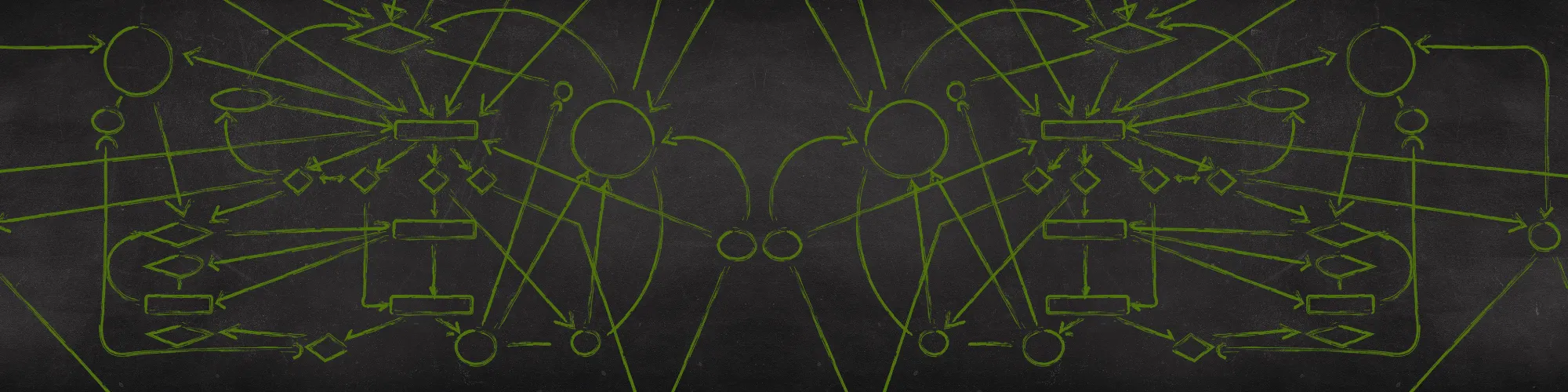7. Dopaminwirkung an Rezeptoren
Dopaminrezeptoren sind überwiegend (und bei Wirbeltieren ausschließlich) an G-Proteine gekoppelt. Es sind metabotrope Rezeptoren, die um Größenordnungen langsamer als ionotrope Rezeptoren,1 und dafür länger anhaltend wirken.
Während ionotrope Rezeptoren unmittelbar einen Ionenkanal öffnen, wird bei exzitatorischen Dopaminrezeptoren ein erregendes G-Protein aktiviert,
das sich an der Innenseite der Zellmembran in der Nähe des Rezeptors befindet. Dieses G-Protein aktiviert ein Enzym, das wiederum einen Second messager (einen sekundären Botenstoff) produziert. Dieser Second messenger diffundiert zu nahegelegenen Ionenkanälen, heftet sich dort an und öffnet diese. Die Stimulation eines inhibitorischen Dopaminrezeptors aktiviert dagegen hemmende G-Proteine, die die Produktion von Second messengern hemmen.2
Ein wichtiger von Dopaminrezeptoren adressierter Second messenger ist das zyklische Adenosinmonophosphat, cAMP. cAMP kann neben der Öffnung von Ionenkanälen auch die Gentranskription auslösen und die Expression spezifischer Gene verändern.
Es existieren 2 Klassen von Dopaminrezeptoren, die sich nach G-Protein-Partnern und intrazellulären Signalmechanismen unterschieden:3
Die D1-artigen Rezeptoren (D1 und D5) sind Gs/olf-gekoppelt. Ihre Aktivierung erhöht intrazelluläres cAMP und wirkt erregend.
Die D2-artigen Rezeptoren (D2, D3 und D4) sind Gi/o gekoppelt. Ihre Aktivierung verringert intrazelluläres cAMP und wirkt hemmend.
Die D1-ähnlichen Dopaminrezeptoren (D1 und D5) werden “postsynaptisch” durch Dopamin aktiviert, das vom präsynaptischen Neuron in den synaptischen Spalt freigesetzt wird. Bei Aktivierung verstärken sie die neuronale Aktivität. Dies ist eine phasische Reaktion.
Die D2-ähnlichen Dopaminrezeptoren sind teils postsynaptisch, können aber auch präsynaptisch auftreten. Präsynaptische Dopaminrezeptoren werden durch extrazelluläres Dopamin aktiviert, das aus der Synapse austritt. Diese Wirkung dient als hemmender Rückkopplungsmechanismus, wenn der Dopaminspiegel die Wiederaufnahmekapazität übersteigt.4 Postsynaptisch wirken D2-ähnliche Rezeptoren hemmend auf die Aktivität der Nervenzelle.
Es ist offen, ob die Dopaminübertragung durch einen synaptischen oder einen volumenabhängigen Mechanismus vermittelt wird. Die Dopamin-abhängige Übertragung funktioniert anders als ein rein synaptischer Mechanismus. Während Glutamat weniger als 1 ms lang im synaptischen Spalt vorhanden ist, und der zeitliche Verlauf der NMDA-abhängigen Übertragung von der Abschaltrate von Glutamat vom Rezeptor abhängt (tau = 250-400 ms, muss Dopamin etwa 100 ms lang vorhanden sein, um die volle Amplitude des IPSC zu erreichen.5
Ratten mit geringer Dopaminrezeptordichte im Striatum, mit also geringerer dopaminerger Bindungskapazität, sind für belohnende / verstärkende Substanzen empfänglicher.6
Neben der Signalübertragung über das Adenylylcyclase-cAMP-System (der wichtigste Wirkmechanismus), aktivieren Dopaminrezeptoren auch die Phospho-Lipase C über das Gq/11-System und erhöhen den intrazellulären Kalziumspiegel. Dopaminrezeptoren interagieren daneben mit Glutamatrezeptoren und mobilisieren intrazelluläre Ca2+ -Speicher.7
Dopamin-Rezeptoren können als Monomere, als dimere und/oder als oligomere Komplexe auftreten. Dies kann durch Assoziation verschiedener Subtypen, entweder allein oder mit anderen GPCRs und ligandengesteuerten Kanälen erfolgen. Als Homodimere treten auf:
- D1R-D2R
- D2R-D4R
- D1R-D3R
- D2R-D3R
- D2R-D5R
Dimere/oligomere Komplexe weisen pharmakologische und funktionelle Eigenschaften auf, die sich von denen der sie bildenden Rezeptoren unterscheiden. Oligomere Komplexe mit Dopamin-Rezeptoren können mit Adenosin A1 und A2, serotonergen 5-HT2A-, histaminergen H3-, glutamatergen mGlu5- und NMDA-Rezeptoren assoziiert sein.8
Die Expression von Dopamin (DA)-Rezeptoren beginnt in den frühen Entwicklungsstadien und reift in der Pubertät.9 Damit unterliegt die Entwicklung nicht nur genetischen, sondern auch vielfältigen Umwelteinflüssen.10
- 7.1. Dopamin bindet an viele Rezeptoren und Transporter; Dopaminaffinität
- 7.2. Häufigkeitsverteilung der Dopaminrezeptoren
- 7.3. Dopamin-Entbindung von Dopaminrezeptoren
- 7.4. Dopaminrezeptoren und DAT meist extrasynaptisch
- 7.5. Heterorezeptoren (postsynaptische Rezeptoren)
- 7.6. Autorezeptoren (D2, D3, D4)
- 7.7. Heterodimere und Homodimere
- 7.8. Hochaffiner und niedrigaffiner Rezeptorstatus
- 7.9. Dopamin - Spare Rezeptoren / Rezeptor Reserve?
- 7.10. G-Protein-unabhängige Dopaminrezeptoraktivierung
- 7.11. Dopamin-Agonisten und -Antagonisten
- 7.12. Beeinflussung der Dopaminsignalisierung durch Beeinflussung der Second Messenger
- 7.13. D2 und D3-Rezeptoren bei ADHS verringert?
7.1. Dopamin bindet an viele Rezeptoren und Transporter; Dopaminaffinität
Dopamin bindet nicht nur an Dopaminrezeptoren, sondern - sogar mit ähnlicher Affinität - auch an Noradrenalinrezeptoren, Serotoninrezeptoren und Melatoninrezeptoren sowie an Dopamintransporter und Noradrenalintransporter.1112 (Sortierung von affin zu weniger affin). Innerhalb der Rezeptoren bestehen wiederum Affinitätsunterschiede je nach Genvariante (Sortierung von affin zu weniger affin).13
- Dopamin-Rezeptoren:
- D4: pKi 7,6; Kd 450 [nM]a
- DRD4-2R
- DRD4-4R
- DRD4-7R
- D5: pKi 6,6; Kd 228 [nM]a
- D3: pKi 6,3 - 7,4; Kd 27 [nM]a
- D2: pKi 5,3 - 6,4; Kd 1705 [nM]a
- D2 short (Autorezeptoren)
- D2 long (Heterorezeptoren)
- D2-D4 Rezeptor-Heteromere
- D1: pKi 4,3 - 5,6; Kd 2340 [nM]a
- D4: pKi 7,6; Kd 450 [nM]a
- Dopamintransporter (DAT): pKi 5,3
- Noradrenalin-Transporter (NET): pKi 4,55
- Noradrenalin-Rezeptoren:
- α2-AR: pKi 6,01
- α1-AR-Rezeptoren: pKi 5,6
- β1-ARs: pKi 5,0
- β2-ARs: pKi 4,3
- Serotonin-Transporter (SERT): pKi 4,53
- Melatoninrezeptoren:
- MT1A: pKi 5,15
- MT1B: pKi 5,04
(Ki, Kd: Dissoziationskonstante. Je niedriger, desto affiner)14
(pKi: negative logarithmische Dissoziationskonstante (negativer Logarithmus von Ki), je höher desto affiner)
D3 und D5-Rezeptoren sind hochaffin, D1- und D2-Rezeptoren niedrigaffin auf Dopamin.15 Das frühere Modell, dass D1 niedrigaffin und D2 hochaffin seien16, ist überholt. Auch die aus dieser veralteten Auffassung abgeleitete Präferenz von D2-Rezeptoren für tonisches Dopamin und von D1R für phasisches Dopamin ließ sich nicht bestätigen. D1R wie D2R sprechen auf tonisches und phasisches Dopamin an.17 Von den D2R sollen nur postsynaptische D2R auf tonisches Dopamin ansprechen.18
7.2. Häufigkeitsverteilung der Dopaminrezeptoren
Innerhalb der Gehirnregionen differiert die Häufigkeit der Dopaminrezeptoren:1920
| Gehirnregion | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Striatum | +++2119 | +++21 19 | +1921 | -19 | -19 / Nucleus caudatus: o21 |
| Nucleus accumbens (ventrales Striatum) | +++2119 | +++21 19 | +++19 Shell: +++l21 | +19 | -19 / o21 |
| Substantia nigra | +++21 | ++21 | +21 | SN pars reticulata: +21 | +21 |
| VTA | ++21 | +21 | |||
| Septum | +19 | +19 / ++21 | +1921 | -19 | -19 |
| Tuberculum olfactorium | +++19 | +++21 19 | +19 / +++21 | -19 | -19 |
| Amygdala | +++19 | +19 / ++21 | +19 | +2119 | -19 |
| Hippocampus | +1921 | +19 / ++21 | +1921 | +2119 | +19 |
| Cortex | +19 / ++20 / PFC: +++21 | +19 / -20 / ++21 | +1921 / -20 | +19 / ++20 | -19 /+21 / +21 |
| Entorhinaler Cortex | +21 | ||||
| Prämotorischer Cortex | +21 | ||||
| ACC | +21 | ||||
| Gyrus dentatus | +21 | ||||
| Hypothalamus | +1921 | +19 | +19 | +2119 | -19 / +21 |
| Thalamus | +1921 | +19 / ++21 | +19 | +2119 | +19 |
| Cerebellum | +1921 | +19 | +19 | -19 | -19 |
| Islands of Calleja | +++21 | ||||
| Globus pallidus | +21 | ||||
| Retina | ++21 | ++21 | ++21 | ||
| Hypophyse | +++21 | ||||
| Riechkolben | +++21 |
+++: häufig; ++ moderat; + niedrig; o sehr niedrig; - keine beobachtet; leer: keine Information
Die Häufigkeitsverteilung der Rezeptoren bei der Ratte ist (von häufig nach selten):
- D1 (ca. 3 bis 5 mal so häufig wie D2)
- D2
- D3 (D3 bis D5 sind erheblich seltener als D1 und D2)
- D5
- D4
- D1 und D2 finden sich getrennt auf D1- bzw. D2-MSNs
- D1-MSN
- exprimieren überwiegend D2
- ca. 50 %
- direkter Weg
- projiziert GABAerg aus Striatum in inneres Pallidum und Substantia nigra pars reticulata
- von innerem Pallidum und Substantia nigra pars reticulata weiter GABAerg in Thalamus.
- Ergebnis: Steigerung der Thalamusaktivität (Disinhibition: Zwei hemmende Neurone hintereinandergeschaltet).
- ermöglicht Bewegung und Verstärkungslernen
- D2-MSN
- exprimieren überwiegend D2
- ca. 50 %
- indirekter Weg
- projiziert GABAerg aus Striatum in äußeres Pallidum
- von äußerem Pallidum weiter GABAerg in Nucleus subthalamicus
- von Nucleus subthalamicus weiter glutamaterg zu den GABAergen Neuronen des inneren Pallidum und der pars reticulata des Nucleus niger
- hemmt, inhibiert Bewegung und Verstärkungslernen
- Beide MSN-Typen
- reagieren auf Dopaminfreisetzung aus nicht-synaptischen Varikositäten
- können Synapsen-ähnliche Eingänge von Dopamin-Axonen mit Verbindungen zwischen Dopamin-Varikositäten und GABAergen postsynaptischen Ansammlungen empfangen
- D1-MSN
- D2 werden auch auf Dopaminaxonen exprimiert
Nucleus accumbens:
- D3 häufig
- D1
- D2
Nucleus caudatus:
- D1
- D2
Putamen ventral:
- D3 moderat
Eine Blockade von Dopaminrezeptoren erhöht die Ausschüttung von Acetylcholin. Acetylcholin ist für die Entstehung von extrapyramidalen Symptomen mitverantwortlich.22
7.3. Dopamin-Entbindung von Dopaminrezeptoren
DRD1 und DRD2 geben Dopamin sehr langsam wieder frei (“unbinding”). Die Halbwertszeit der Dopaminfreigabe von DRD1 und DRD2 beträgt 80 Sekunden23 und ist damit sehr viel länger als Bursts, die nur Sekundenbruchteile bis wenige Sekunden andauern.
7.4. Dopaminrezeptoren und DAT meist extrasynaptisch
Rezeptoren befinden sich meist, aber nicht ausschließlich, innerhalb von Synapsen.
Dopaminrezeptoren sitzen überwiegend außerhalb von Synapsen (extrasynaptisch). Dies betrifft auch den D2-Autorezeptor und den für die Dopamin-Wiederaufnahme maßgeblichen DAT.242526
Im Striatum bilden dopaminerge Fasern alle 4 mm En-Passant-Synapsen.27
Aufgrund von Diffusion und Wiederaufnahme (nicht: durch Abbau) beträgt die Halbwertszeit extrazellulären Dopamins im Nucleus caudatus weniger als 50 ms, im Nucleus accumbens ist sie etwas länger.2829 So können D1-Rezeptoren durch DA stimuliert werden, das bis zu 12 Mikrometer von den Freisetzungsstellen entfernt in den extrasynaptischen extrazellulären Raum diffundiert.30
Die Dopaminaufnahme im mPFC, Nucleus accumbens und Nucleus Caudatus / Putamen korreliert mit der Menge der vorhandenen Dopaminrezeptoren. In der Amygdala ist die Dopaminaufnahme dagegen geringer und langsamer und entspricht der des neuroendokrinen tuberoinfundibulären Dopaminsystems.29
7.5. Heterorezeptoren (postsynaptische Rezeptoren)
Freigesetzte Katecholamine wirken an postsynaptischen Heterorezeptoren (hier an hemmenden wie an aktivierenden), sowie an präsynaptischen Autorezeptoren (hier nur hemmende).31
7.5.1. D1-ähnliche-Dopaminrezeptoren: aktivierend
D1R-ähnliche Rezeptoren (D1R und D5R)32
- erhöhen Adenylatzyklase
- insbesondere D1R
- erhöhen den Phosphoinositid-Stoffwechsel
- insbesondere D5R
- befinden sich auf Nicht-Dopamin-Neuronen33
- stimulieren die neuronale Signalübertragung durch Bindung an Gαs/olf, um die Adenylylcyclase zu aktivieren. Das Enzym Adenylylcyclase (AC) wandelt Adenosintriphosphat (ATP) in zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP) um. cAMP aktiviert die Proteinkinase A (PKA), die wiederum das cAMP-Response-Element-Binding Protein (CREB) phosphoryliert. CREB wird in den Zellkern verlagert und aktiviert die CREB-abhängige Transkription von Genen, die an der synaptischen Plastizität beteiligt sind. D1R erhöht Erregbarkeit in axonalen Endbereichen, indem es verschiedene Ionenkanäle moduliert, darunter spannungsaktivierte Na+-, K+- und Ca2+-Kanäle sowie den G-protein gated inwardly rectifying K+-Kanal (GIRK).33433
- D1R-ähnliche Rezeptoren enthalten keine Introns, anders als D2R-ähnliche Rezeptoren, die daher “long” und “short” D2-Rezeptor-Isoformen kennen.11
7.5.1.1. D1-Rezeptor
Häufigster Dopaminrezeptor im dlPFC von Primaten. Vermittelt die meisten zellulären Dopaminwirkungen im dlPFC.35
- niedrigaffin15
- entzündungshemmend (Neuroinflammation)15
- postsynaptisch
- aktivierend
wenn Dopamin an die Rezeptoren D1 oder D5 bindet, wird die jeweils nachfolgende Synapse aktiviert = depolarisiert (exzitatorisches postsynaptisches Potential) - Auftreten:
- Nucleus accumbens (ventrales Striatum) (zusammen mit D3-Rezeptoren)383638
- Riechkolben38
- Basalganglien38
- Hypothalamus
- Thalamus
- (lediglich) in Projektionen (ohne mRNA) aus striatalen GABAergen Zellen, die zugleich Substanz P produzieren, in
- Entopeduncularer Nucleus
- Globus pallidus
- Substantia nigra pars reticulata
- geringer auch im PFC38
- Agonisten:
- (R)-SKF82526; Kd: 28 nM am DRD1; KL: 21 nM am DRD1 striatal40
- SKF3839336; Kd: 150 nM am DRD1; KL: 381 nM am DRD1 striatal40
- (R)-(+)-6-Br-APB; Kd: 384 nM40
- (R)-apomorphine; Kd: 680 nM; KL: 206 nM am DRD1 striatal40
- (S)-SKF8252636; Kd: 1818 nM an DRD1; KL: 1.1335 nM am DRD1 striatal40
- (R)-NPA; Kd: 1816 nM am DRD1; KL: 625 nM am DRD1 striatal40
- (+)-6,7-ADTN; Kd: 4600 nM am DRD1; KL: 734 nM am DRD1 striatal40
- Dopamin; Kd: 2.500 nM (2,5 μM) am DRD1; KL: 580 nM am DRD1 striatal40
- Serotonin; Kd: 9690 nM am DRD1; KL: 6.543 nM am DRD1 striatal40
- Noradrenalin; Kd: 50.000 nM (50 μM) am DRD1; KL: 4.141 nM am DRD1 striatal40
- Adrenalin; Kd: 55 000 nM am DRD1; KL: 980 nM am DRD1 striatal40
- Bromocriptin
- Fenoldopam36
- A7763611
- SKF-8129711
- SKF-8395911
- Antagonisten:
Beteiligt an der Entstehung aversiver Erinnerungen.
Reguliert das anhaltende Feuern von dlPFC-Neuronen während der Verzögerungsphase von Aufgaben mit verzögerter Reaktion, die ein Arbeitsgedächtnis erfordern.35
Die Blockade von D1-Rezeptoren störte die kortikostriatale Langzeitpotenzierung (LTP, “Lernen”), während die Blockade von D5-Rezeptoren die LTD (Long Term Depression, “Vergessen”) verhinderte.41
Blockade von D1-Rezeptoren steigerte die motorische Aktivität, während eine Blockade von D1 und D5-Rezeptoren die motorische Aktivität verringerte.41
In mPFC-Pyramiden-Neuronen sind D1-Rezeptoren auf dendritischen Stacheln und D5-Rezeptoren auf dendritischen Schäften stärker ausgeprägt. Eine gleichzeitige pharmakologische Aktivierung von D1- und D5-Rezeptoren im mPFC durch den D1- und D5-Agonisten SKF-38393 förderte die Entstehung aversiver Erinnerungen.42
D1R spielen eine Rolle bei der Suchtentwicklung. D1R-KO-Mäuse zeigten eine verringerte Suchtanfälligkeit.43 Im Gegensatz dazu ist ein verringerte D2-Autorezeptor suchtfördernd.44
Nach der Geburt nimmt die Dichte der D1 und D2 Rezeptoren im Striatum zunächst zu. In der Adoleszenz sinkt die Anzahl dieser Rezeptoren auf 40 % des Ausgangsniveaus ab.45 Diese Abnahme ist bei Männern wiederum deutlich stärker als bei Frauen.
Eine hohe Expression von Dopamintransportern könnte möglicherweise eine erhöhte Expression von D1-, D2- und VMAT2-Rezeptoren bewirken.46
Glucocorticoide bewirken eine Sensitivierung von D1-Rezeptoren in GABAergen Zellen des Striatums bei Ratten,4748 ebenso wie Stress.4950
7.5.1.2. D5-Rezeptor
Beteiligt an der Entstehung aversiver Erinnerungen.
In mPFC-Pyramiden-Neuronen sind D1-Rezeptoren auf dendritischen Stacheln und D5-Rezeptor auf dendritischen Schäften stärker ausgeprägt. Eine gleichzeitige pharmakologische Aktivierung von D1- und D5-Rezeptoren im mPFC durch den D1- und D5-Agonisten SKF-38393 fördert die Entstehung aversiver Erinnerungen.42
- hochaffin15
- D5 ist bis zu 10-mal so Dopamin-affin wie D111
- entzündungsfördernd (Neuroinflammation)15
- postsynaptisch
- aktivierend: bindet Dopamin an die Rezeptoren D1 oder D5, wird die jeweils nachfolgende Synapse aktiviert = depolarisiert (exzitatorisches postsynaptisches Potential)
- Auftreten:
- Agonisten:
- Antagonisten:
7.5.2. D2-ähnliche Dopaminrezeptoren: hemmend
D2R-ähnliche Rezeptoren (D2R, D3R und D4R) sind hemmend. Sie induzieren durch Kopplung an Gi/o-Proteine:351
- die Hemmung von AC- und PKA-abhängigen Signalwegen
- die Aktivierung von hemmenden G-Protein-aktivierte, einwärts gerichtete Kaliumkanäle (GIRK)
- das Schließen von spannungsaktivierten Ca2+-Kanälen.
- die Aktivierung der Phospholipase C11
Die Mehrzahl der D2-Rezeptoren befindet sich auf Nicht-Dopamin-Neuronen (postsynaptisch).33 Zu den präsynaptischen Autorezeptoren siehe unten.
D2R-ähnliche Rezeptoren enthalten Introns und kennen daher “long” und “short” D2-Rezeptor-Isoformen, anders als D1R-ähnliche Rezeptoren.11
Für eine Aktivierung oder Deaktivierung der nachfolgenden Synapse muss ein bestimmter Prozentsatz der aktivierenden oder inhibierenden (hier: Dopamin-) Rezeptoren mittels Dopaminbindung initiiert werden. Befindet sich aufgrund der Überaktivität der Dopaminwiederaufnahmetransporter zu wenig Dopamin im synaptischen Spalt, werden nicht genug Rezeptoren initiiert. In der Folge unterbleibt die eigentlich fällige Aktivierung / Deaktivierung der nachfolgenden Synapse.
Das Gehirn trifft die Entscheidung zu einer Handlung bereits bis zu 7 Sekunden, bevor der Person die Entscheidung selbst bewusst wird. Diese 7 Sekunden stehen dem Menschen zur Verfügung, um eine bereits “getroffene” Entscheidung noch zu unterdrücken – mittels inhibitorischer Deaktivierung der Synapsen, die die Entscheidung weitergeben. Noch 200 Millisekunden vor der Ausführung kann der Mensch die bereits getroffene Entscheidung abbrechen.52
Bildlich gesehen stellt ein Gehirnbereich beabsichtigte Entscheidungen “zur Diskussion” und gibt anderen Gehirnregionen die Möglichkeit, diese zu beurteilen und zuzulassen oder zu unterbinden.
Dieser Prüfungs- und Abbruch-Mechanismus wird ganz wesentlich von Dopamin gesteuert. Ist der Dopamin-Regelkreislauf gestört, ist der Mechanismus, der zu Abbruch von nachteiligen Entscheidungen führt, gehemmt.
7.5.2.1. D2-Rezeptor
- niedrigaffin,15 jedenfalls in vivo genauso niedrigaffin wie D11
- keine Aktivierung durch basale Dopaminspiegel (2 bis 20 nM)
- Aktivierung bei 100 μM durch phasische Dopaminausschüttung
- entzündungshemmend (Neuroinflammation)15
7.5.2.1.1. Erscheinungsformen
D2R gibt es präsynaptisch (short) und postsynaptisch (long)53 54 in Substantia nigra, VTA und Striatum55
7.5.2.1.1.1. D2 long
7.5.2.1.1.2. D2 short (Autorezeptor)
- präsynaptisch5657
- finden sich auf dopaminergen Neuronen (Autorezeptoren)55
- auf Zellkörpern
- auf Dendriten
- auf Endigungen im nigrostriatalen und mittelhirn-limbischen System
- Autorezeptoren = hemmender Rückkopplungsmechanismus durch Veränderung von56
- DA-Synthese
- DA-Freisetzung
- DA-Wiederaufnahme
als Reaktion auf zunehmende Menge an extrazellulärem synaptischen Dopamin. - D2-Autorezeptoren auf Dopamin-Axonen reagieren auf tonisches und phasisches Dopamin5859
- Ihre Aktivierung
- hemmt die Dopaminsynthese
- steigert die Dopaminaufnahme
- reguliert die VMAT2-Expression60
- Ihre Aktivierung
- D2-Autorezeptoren im Soma
- Aktivierung hemmt das Feuern von Dopaminneuronen61
- bislang sind keine selektiven D2-Autorezeptor-Agonisten oder -Antagonisten bekannt62
- hemmend:
wenn Dopamin an die Rezeptoren D2, D3 oder D4 bindet, wird die jeweils nachfolgende Synapse gehemmt = polarisiert (inhibitorisches postsynaptisches Potential) - hemmt Adenylylcyclase36
- hemmt cAMP-Produktion
- D2 short hemmt cAMP effektiver und benötigt hierfür weniger Agonisten als D2 long36
- verstärkt die ATP- oder Calcium-Ionophor-induzierte Arachidonsäure-Freisetzung in CHO-Zellen36
- erhöht den intrazellulären Calciumspiegel in36
- Ltk-Zellen
- durch erhöhte PI-Hydrolyse
- CCL1.3-Zellen
- durch erhöhte PI-Hydrolyse
- CHO-Zellen
- hier allerdings nicht durch erhöhte PI-Hydrolyse
- Ltk-Zellen
- Je mehr Dopaminrezeptoren vorhanden sind, desto größer ist der acetylcholinerge Überschuss, der im Falle einer Blockade dieser Rezeptoren entsteht.
- Eine Gabe von typischen Antipsychotika (= typische Neuroleptika, z.B. Haloperidol), die als D2 Antagonisten die postsynaptischen Dopamin-D2-Rezeptoren blockieren, bewirkt bei Betroffenen mit hoher Anzahl von Dopaminrezeptoren ausgeprägte acetylcholinerge Nebenwirkungen wie Extrapyramidalsymptome oder Akathisie (Taskinesie, Sitzunruhe). Der acetylcholinerge Überschuss bei Betroffenen mit hoher Anzahl von Dopaminrezeptoren erklärt den häufigen Konsum von anticholinerg wirkenden und sedierenden Substanzen sowie den häufigen Kokainkonsum.
7.5.2.1.1.3. D2R-High und D2R-Low
Weitere Unterscheidung (zusätzlich zu long und short) DRD2-High und DRD2-Low.
DRD2-High (aktivere Form) sind mit dem Second-Messenger-Systemen verbunden, für funktionelle Effekte verantwortlich ist haben eine hohe Affinität für Agonisten.
DRD2-Low (inaktivere Form= sind funktionell inert (vermittelt keine oder geringe funktionellen Effekte) ist und gering affin für Agonisten63
7.5.2.1.2. Vorkommen von D2R
- Striatum (zusammen mit D1-Rezeptoren)38
- exprimiert durch GABAerge Neuronen, die zugleich Enkephaline exprimieren36
- D2 werden auch auf Dopamin-Axonen exprimiert
- Riechkolben38
- exprimiert durch GABAerge Neuronen, die zugleich Enkephaline exprimieren36
- Nucleus accumbens 38
- exprimiert durch GABAerge Neuronen, die zugleich Enkephaline exprimieren36
- Substantia nigra pars compacta
- exprimiert durch dopaminerge Neuronen36
- ventrales Tegmentum
- exprimiert durch dopaminerge Neuronen36
- Nebenniere
- hier reguliert der D2R die Produktion und Abgabe von PRL
- Keine D2RS-Autorezeptoren in (mindestens bestimmten Teilen der) mesokortikalen Zellen6465
7.5.2.1.3. D2-Agonisten
- (R)-Apomorphin; Kd: 24 nM am DRD2; KL: 127 nM am DRD2 striatal40
- (R)-SKF82526h; Kd: 28 nM; KL: 23 nM am DRD2 striatal40
- (R)-(+)-6-Br-APB; Kd: 384 nM40
- (S)-SKF82526; KL: 1.000 nM am DRD2 striatal40
- (R)-NPA; Kd: 20 nM an DRD240
- (+)-6,7-ADTN; KL: 463 nM am DRD2 striatal40
- Dopamin; Kd: 1.705 bis 17.000 nM (2,5 μM) am DRD2; KL: 4.300 nM am DRD2 striatal40
- SKF38393; Kd: 9.500 nM an DRD240
- Noradrenalin; KL: 126.000 nM am DRD2 striatal40
- Adrenalin; KL: 128.000 nM am DRD2 striatal40
- Serotonin; KL: 183.000 am DRD2 striatal40
- Bromocriptin36
- Apomorphin36
- N043766
- Noradrenalin53
- Noradrenalin ist auf D2-Typ-Rezeptoren unterschiedlich affin: D3R > D4R ≥ D2SR ≥ D2L
- MLS154711
- Rotigotine11
- Ropinirole11
- Pramipexole11
- PD 12890711
- PD168,07711
- A41299711
7.5.2.1.4. D2-Antagonisten
- Spiperon3666
- Racloprid366611
- Sulpirid3611
- Haloperidol
- Paliperidon, (RS)-3-{2-[4-(6-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidino]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on; 9-Hydroxy-Risperidon
- L74162666
- Clozapin67
- stärkerer D4- als D2-Antagonist
- Pipotiazin11
- Perospiron11
- ML32111
- Prochlorperazin11
- NGB 290411
7.5.2.1.5. D2-Antagonisten-Agonisten
- Aripiprazol68
- D2-Rezeptor-Partialagonismus
- wirkt bei Dopamin-Überschuss als Antagonist, bei Dopaminmangel als Agonist.
- wirkt hemmend gegen dopaminerge Überfunktion im mesolimbischen System und aktivierend gegen dopaminerge Unterfunktion im mesocorticalen System. Dadurch geringe Gefahr von übermäßiger D2-Rezeptor-Blockade in Striatum oder Hypophyse
- Serotonin-5-HT1A-Rezeptor-Partialagonismus
- 5-HT2A-Rezeptor-Antagonismus
- nur sehr schwacher Prolaktin-Agonist
- Einsatz. Schizophrenie
- D2-Rezeptor-Partialagonismus
7.5.2.1.6. Gifte
Reduzierung der D2-Rezeptoren durch69
- Pestizide
- Quecksilber
- Formaldehyd
7.5.2.1.7. Wirkung
Eine Blockade von D2-Auto-Rezeptoren führt zu einer Erhöhung des Dopaminspiegels.70
Nach der Geburt nimmt die Dichte der D1 und D2 Rezeptoren im Striatum zunächst zu. Die Zunahme von D2 Rezeptoren nach der Geburt ist bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen.71
In der Adoleszenz sinkt die Anzahl dieser Rezeptoren auf 40 % des Ausgangsniveaus ab.45 Diese Abnahme ist bei Männern wiederum deutlich stärker als bei Frauen.
Mit zunehmendem Alter nimmt die Dichte der D2-Rezeptoren im Striatum ab.72
Eine hohe Expression von Dopamintransportern könnte möglicherweise eine erhöhte Expression von D1-Rezeptoren, D2-Rezeptoren und VMAT2-Rezeptoren bewirken.46
Eine recht kleine Studie an Kindern mit ADHS (von denen etliche eine Frühgeburt erfahren bzw. mit niedrigem Gewicht geboren wurden) fand bei ADHS-C-Betroffenen Hinweise auf eine geringere D2-/D3-Rezeptorbindung /-anzahl als bei Betroffenen des ADHS-I-Subtyps: ADHS-C: 2,9 (2,6 – 3,5); ADHS-I: 4,0 (3,3 – 4,5).73
D2- und D3-Agonisten verstärken Kataplexie (Narkolepsie-Symptom), D2- und D3-Antagonisten verringern sie.74
D2- und D3-Agonisten scheinen den REM-Schlaf nicht zu beeinflussen.74
D2R reguliert positive Emotionalität und Extraversion.75
- D2-, D3- und D4-Rezeptoren wirken
- Prolaktin aktivierend
- Acetylcholin inhibierend
7.5.2.3. D3-Rezeptor
Der DRD3 ist möglicherweise als einziger Dopaminrezeptor nicht mit ADHS assoziiert.767778
- hochaffin15
- entzündungsfördernd (Neuroinflammation)15
- präsynaptisch und postsynaptisch
- hemmend:
wenn Dopamin an die Rezeptoren D2, D3 oder D4 bindet, wird die jeweils nachfolgende Synapse gehemmt = polarisiert (inhibitorisches postsynaptisches Potential)- hemmt Adenylylcyclasen
- geringer als D2-Rezeptoren in36
- CHO 10001 Zellen
- 293 Zellen
- NG108-15 Zellen
- und gar nicht in
- GH4C1 Zellen
- MN9D Zellen
- SK-N-MC Zellen
- CHO-Kl Zellen
- NG108-15 Zellen
- CCL1.3 Zellen
- geringer als D2-Rezeptoren in36
- zumindest in CHO Zellen oder GH4CI Zellen wurde keine Verstärkung der ATP- oder Calcium-Ionophor-induzierten Arachidonsäure-Freisetzung festgestellt36
- keine Stimulation der PI-Hydrolyse36
- hemmt Adenylylcyclasen
- Auftreten
- vorwiegend im limbischen System7938
- Nucleus accumbens
- Riechkolben
- Cerebellum
- da das Cerebellum über keine dopaminergen Projektionen (Kommunikationsbahnen) mit anderen Gehirnbereichen verbunden ist, wird angenommen, dass D3-Rezeptoren hier nichtsynaptische dopaminerge Funktionen ausüben
- Islands of Calleja (einer Gruppe dicht gepackter kleinen Zellen im Cortex des Gyrus Hippocampus)
- gering im Nucleus accumbens (ventrales Striatum)67
- D3-Rezeptor-Agonisten
- Quinpirol36
- 7-OH-DPAT36
- Apormophin36
- Pramipexol, (S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazol; (S)-2-Amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol11
- Ropinirol, 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indolin-2-on11
- (+)-PD12890766
- Noradrenalin53
- Noradrenalin ist auf D2-Typ-Rezeptoren unterschiedlich affin: D3R > D4R ≥ D2SR ≥ D2L
- Rotigotin11
- PD 12890711
- A41299711
- [3H]PD12890711
- Antagonisten:
D2- und D3-Agonisten verstärken Kataplexie (Narkolepsie-Symptom), D2- und D3-Antagonisten verringern sie.74
D2- und D3-Agonisten scheinen den REM-Schlaf nicht zu beeinflussen.74
- D2-, D3- und D4-Rezeptoren wirken
- Prolaktin aktivierend
- Acetylcholin inhibierend
7.5.2.4. D4-Rezeptor
D4-Rezeptoren sind in die Kodierung der Erinnerung von Angst involviert, nicht aber in die Kodierung der Erinnerung von Belohnungen.42 D4R sind an der Regulation von Handlungsimpulsivität (Inhibitionsproblemen) und Wahlimpulsivität (Abwertung entfernter Belohnungen) beteiligt.75
D4R findet sich bei Menschen, Primaten und Nagetieren vor allem im PFC, insbesondere in Neuronen der tiefen Schicht. Dagegen ist die DRD4-mRNA-Expression im Striatum viel geringer.75
- eher hochaffin
- präsynaptisch und postsynaptisch
- hemmend:
wenn Dopamin an die Rezeptoren D2, D3 oder D4 bindet, wird die jeweils nachfolgende Synapse gehemmt = polarisiert (inhibitorisches postsynaptisches Potential)- hemmt Adenylylcyclasen, jedoch nur in manchen Zelllinien36
- verstärkt die ATP- oder Calcium-Ionophor-induzierte Arachidonsäure-Freisetzung in CHO-Zellen36
- keine Stimulation der PI-Hydrolyse36
- die Aktivierung von D4R im PFC hält das Ausgangssignal des PFC-Netzwerks niedrig75
- D4R-KO-Mäuse zeigen eine Übererregbarkeit frontaler kortikaler P-Neuronen7580
- der Funktionsgewinn durch D4.7R zeigt dagegen eine Abnahme der kortiko-striatalen glutamatergen Übertragung81
- D4R in frontalen kortiko-striatalen Terminalen vermitteln eine signifikante Hemmung der striatalen Glutamatfreisetzung75
- Nagetiere mit neonatalen 6-OH-Dopamin-Läsionen zeigen typische ADHS-Symptome, darunter lokomotorische Hyperaktivität, bei zugleich erhöhter striataler D4R-Dichte82
- D4R können indirekt die Funktion von Adrenozeptoren und anderen Dopaminrezeptor-Subtypen durch Heteromerisierung modulieren75
- Auftreten:
- seltener als andere Dopaminrezeptoren
- PFC
- Medulla
- Limbische Regionen38
- Amygdala
- Hypothalamus
- Mittelhirn (Mesencelaphon)
- Herz
- Retina85
- Pinealozyten der Zirbeldrüse86
- diese sind durch die Melatoninausschüttung ins circadiane System involviert
- geringes Auftreten im Striatum6787 und den übrigen Basalganglien
- Häufigkeitsverteilung PFC > Mittelhirn > Amygdala > Striatum84
- Varianten88
- DRD4.2R: 2 Repeats (8 %)
- DRD4.4R: 4 Repeats (60 %)
- DRD4.7R: 7 Repeats (20 %)
- im Vergleich zu DRD4.4R:75
- höhere Unterdrückung von Netzwerk-Bursts und NMDA-Rezeptor-vermittelten exzitatorischen postsynaptischen Strömen von P-Neuronen in vitro
- stärkere Downregulation von NR1-NMDA-Rezeptor-Oberflächenexpression in frontalkortikalen Zellen in vitro
- abgeschwächte Methamphetamin-induzierte kortikale Aktivierung
- abgeschwächte ontogenetische und Methamphetamin-induzierte Glutamatfreisetzung frontal kortiko-striatal
- stärkere Hemmung der frontalen kortiko-striatalen Neurotransmission durch:
- spezifisch höhere Dopamin-Potenz beim D2R-D4.7R-Heteromer als beim D2R-D4.4R-Heteromer, im Vergleich zum D2R-Homomer
- unterschiedliche Abnahme oder Zunahme der konstitutiven Aktivität von D2R, wenn es D2R-D4.4R bzw. D2R-D4.7R-Heteromere bildet
- häufigere Bildung von D4.7R-Homomeren statt Heteromeren als bei D4.4R
- D4.7R bildet seltener Heteromere mit D2R als D4.4R
- D4.7R bildet häufiger Homomere als D4.4.R
- signifikant höhere Dopaminwirkung für D4.4R-D4.4R- und D4.7R-D4.7R-Homomere als für D2R-D4.4R- und D2R-D4.7R-Heteromere führt ebenfalls zu Funktionssteigerung von D4.7R im Vergleich zu D4.4R
- seltener Bildung von D4.7R-α2AR Heteromeren als von D4.4R-α2AR im Gehirn
- D4.7R-α2AR erhöht die Wirksamkeit von Noradrenalin bei der Aktivierung von α2AR, nicht aber D4.4R-α2AR
- D4.7R hemmt nicht allosterisch die α2AR-vermittelte Signalübertragung im Heteromer, im Vergleich zu D4.4R
- daher hemmt Dopamin die α2AR-Signalübertragung in α2AR-D4.7R nicht, wohl aber in α2AR-D4.4R-Heteromeren
- D4R kann auch durch endogenes Noradrenalin in der Großhirnrinde aktiviert werden
- hohes Dopamin sollte eine signifikante Hemmung der α2AR-Signalübertragung durch das α2AR-D4.4R, nicht aber durch das α2AR-D4.7R-Heteromer bewirken
- α2AR-D4R-Heteromere scheinen vornehmlich die Erregbarkeit von P-Neuronen zu verringern
- daher höher frontal-kortikale Hemmung durch D4.7R
- im Vergleich zu DRD4.4R:75
- keine signifikanten Unterschiede zwischen D4.2R, D4.4R und D4.7R hinsichtlich Dopamin-induzierter Aktivierung der fünf Gi/o-Protein-Subtypen75
- Agonisten
- Apormophin36
- Quinpirol36
- Dopamin36
- FAUC 17989
- (-)-(R)-N-Propylnorapomorphin66
- L-745,87066
- Noradrenalin53
- Noradrenalin ist auf D2-Typ-Rezeptoren unterschiedlich affin: D3R > D4R ≥ D2SR ≥ D2L
- Noradrenalin bindet und aktiviert D4Rs bei submikromolaren Konzentrationen, die bis zu zehnmal höher sind als die Konzentration, die β1R oder α1BR in Zirbeldrüsen-Präparationen oder Zirbeldrüsengewebe aktivieren kann.75
- Rotigotin11
- PD168,07711
- A41299711
- Antagonisten:
Selektive D4-Antagonisten erwiesen sich zur antipsychotischen Behandlung als ineffektiv. Offenbar bedarf es einer kombinierten Behandlung des dopaminergen und serotonergen Systems.90
Injektionen des selektiven D4R-Agonisten A-412997 (5 und 10 mg/kg) und des Antagonisten L-745870 (5 und 10 mg/kg) veränderten die Aktivität von Hippocampus und PFC signifikant.
Der D4R-Agonist A-412997 verstärkte den langsamen Rhythmus des PFC (delta, 2-4 Hz) und unterdrückte den Theta-Rhythmus des Hippocampus.
Der D4R-Antagonist L-745870 hatte den entgegengesetzten Effekt. Analoge Veränderungen der beiden langsamen Rhythmen fanden sich auch im Nucleus reuniens des Thalamus, der Verbindungen zu beiden Vorderhirnstrukturen hat. Langsame Oszillationen spielen eine Schlüsselrolle bei der interregionalen kortikalen Kopplung; insbesondere wurde gezeigt, dass Delta- und Theta-Oszillationen das neuronale Feuern mitreißen und die Gamma-Aktivität in miteinander verbundenen Vorderhirnstrukturen modulieren, wobei das Hippocampus-Theta gegenüber dem PFC relativ dominiert. D4R-Aktivierung scheint somit eine anormale Verzerrung in der bidirektionalen PFC-Hippocampus-Kopplung hervorrufen zu können, die durch D4R-Antagonisten rückgängig gemacht werden kann.91
D4R moderieren Handlungsimpulsivität und Wahlimpulsivität (zusammen mit DAT, COMT und α2AR).75
- D2-, D3- und D4-Rezeptoren wirken
- Prolaktin aktivierend
- Acetylcholin inhibierend
7.6. Autorezeptoren (D2, D3, D4)
Die Darstellung dieses Absatzes basiert auf Ruskin et al.31 sowie Cooper et al.92
Freigesetzte Katecholamine wirken nicht nur an postsynaptischen Heterorezeptoren (hier an hemmenden wie an aktivierenden), sondern auch an präsynaptischen Autorezeptoren. Autorezeptoren sind immer hemmend (D2, selten auch D3 und D4).
7.6.1. Wirkung dopaminerger Autorezeptoren
Dopaminerge Autorezeptoren steuern drei Dinge:
- die dopaminerge Feuerrate
- die Dopaminsynthese
- die Dopaminfreisetzung.
Autorezeptoren finden sich präsynaptisch auf vielen Bereichen dopaminerger Neuronen, unter anderem auf:
-
Soma (D2)
-
Dendriten (D2)
-
Terminalen (D2)
- Autorezeptor-Stimulation verringert:92
- Dopaminsynthese
- Dopaminfreisetzung
- Autorezeptor-Stimulation verringert:92
-
In PFC und ACC gebe es keine terminalen Autorezeptoren, die die Dopaminsynthese beeinflussen92
-
im PFC gebe es terminale, aber keine somatodendritischen Autorezeptoren94
Die Aktivierung von D2-Autorezeptoren durch
- exogene Verabreichung von Agonisten
- bewirkt eine Kaliumleitwert-vermittelte Hemmung von Neuronen in der Substantia nigra und im VTA95
- eine elektrische Stimulation
Die Wirkung von Autorezeptoren ist abhängig von ihrer zeitlichen Aktivierung in Relation zum Aktionspotenzial.
Werden D2-Autorezeptoren unmittelbar vor dem Aktionspotenzial aus der Nervenzelle aktiviert, unterdrückten sie die Dopaminausschüttung vollständig. Je später sie nach dem Aktionspotenzial aktiviert wurden, desto schwächer wurde die Hemmung. Eine D2-Aktivierung 90 ms nach dem Aktionspotenzial hemmte nur noch um knapp 20 %, ab rund 200 ms nach dem Aktionspotenzial hemmte sie gar nicht mehr. Die Hemmung blieb für 10 Minuten vollständig erhalten und nahm dann über 30 Minuten ab.5
7.6.2. Up-/Downregulation dopaminerger Autorezeptoren
Autorezeptoren sind 5- bis 10-mal empfindlicher auf Agonisten (z.B. Dopamin oder Apomorphin) als postsynaptische Dopaminrezeptoren.94 Daher reagieren Autorezeptoren auf Agonisten schneller mit einer Downregulation als postsynaptische Rezeptoren.9899100101
Autorezeptoren unterliegen einer deutlichen Up- und Downregulation.9294
Chronische Gabe von D2-Antagonisten oder eine lang anhaltende Dopaminverringerung bewirken deren erhöhte Sensibilisierung (Upregulation).
Chronische Gabe von D2-Agonisten bewirken deren verringerte Sensibilisierung (Downregulation).
Folglich sollten niedrige Dosen direkt wirkender Agonisten bevorzugt Autorezeptoren aktivieren, was eine verringerte tonische Spikebildung und verringerte Transmitterfreisetzung und somit eine verringerte Aktivierung postsynaptischer Dopamin-Rezeptoren bewirkt, welche dann motorische Aktivierung vermitteln.
- Niedrige Dosen direkter Dopamin-Agonisten
- verringern das spontane motorische Verhalten
- Höhere Dosen direkter Dopamin-Agonisten
- können postsynaptische Rezeptoren auch direkt aktivieren
- steigern damit die motorische Aktivität
Aus diesem Modell wurde die Hypothese abgeleitet, dass niedrige Stimulanziendosen bei ADHS beruhigend wirken, indem sie die Dopamin-Übertragung verringern.102
Stimulanzien wie MPH und AMP sind jedoch keine direkt wirkenden Dopamin-Rezeptor-Agonisten, sondern wirken indirekt. Zudem wirkt D-AMP in den Basalganglien gleich stark auf postsynaptische wie präsynaptische Rezeptoren.101
7.6.3. Agonisten und Antagonisten
D2-Autorezeptoren werden nur sehr gering von tonisch ausgeschüttetem extrazellulärem Dopamin aktiviert. Die Aktivierung erfolgt offenbar maßgeblich durch phasisch ausgeschüttetes Dopamin, das aus dem synaptischen Spalt in den Extrazellulärraum diffundiert.5 Eine hohe Konzentration (30-100 μM) von synaptisch freigesetztem Dopamin bindet innerhalb von weniger als 30 ms103 für rund 90 ms5 an den D2-Autorezeptor und löst dessen Wirkung aus.
Der D2-Autorezeptor wird auch durch Noradrenalin aktiviert, wobei seine Affinität für Noradrenalin schwächer ist als für Dopamin.5
Es gibt einige relativ selektiv wirkende Autorezeptor-Agonisten und -antagonisten:98
- Selektive Autorezeptor-Agonisten:
- 3-PPP
- EMD 23-448
- Selektive Autorezeptor-Antagonisten:
- (+)-UH232
- (+)-AJ76
7.6.4. Dopaminregulation durch postsynaptische Dopaminrezeptoren
Die Regulation der dopaminergen Aktivität wird nicht in allen Gehirnregionen durch Autorezeptoren gesteuert. Während die Feuerrate der Dopaminneuronen der Substantia nigra pars compacta durch somatodendritische Autorezeptoren reguliert wird, erfolgt die Feuerungsregulierung des Globus pallidus durch postsynaptische Dopamin-Rezeptoren des Striatum und des Globus pallidus selbst.
In peripheren Motorneuronen kann eine präsynaptische Hemmung durch Signale von Interneuronen vermittelt werden.93
7.7. Heterodimere und Homodimere
Dopaminrezeptoren bilden rein dopaminerge Heteromere als auch Heteromere mit anderen Rezeptorfamilien, z.B.:
- D1 / D2 - Heterodimere104
- D1 / D3 - Heterodimere107
- relevant bei Sucht105
- D2 / D2-Homodimere108
- D2 / D3-Heteromere105
- relevant bei Schizophrenie105
- D2 / D4-Heteromere75
- in striatalen Terminals
- möglicherweise in der perisomatischen Region von P-Neuronen im Striatum
- relevant bei ADHS105- -
- D2 / D5-Heteromere105
- D4 / Alpha1A Adrenozeptor - Heteromere109
- relevant bei ADHS: -D4.7 / Alpha1A Adrenozeptor - Heteromere
- relevant bei PTBS: -D4.4 / Alpha1A Adrenozeptor - Heteromere
- D1 / Adenosin A1 - Heteromere105
- relevant bei Sucht105
- D2 / Adenosin-A2A - Heterodimere scheinen teilweise für die psychomotorischen und verstärkenden Wirkungen von Psychostimulanzien wie Kokain und Amphetamin verantwortlich zu sein.110
- Sucht, Schizophrenie, Parkinson105
- D2 / Adenosin-2A / Glutamat Metabotropic mGlu(5) - Heterotrimere im Striatum111
- relevant bei Schizophrenie105
- D2 / Cannabinoid-CB1 - Heterodimere im Striatum112
- D2 / Cannabinoid-CB1 / Adenosin-2A - Heretotrimere113114
- D1 / NMDA-Heteromer105
- relevant bei Schizophrenie105
- D2 / NMDA-Heteromer105
- relevant bei Sucht105
- D2 / 5HT2A-Heteromer105
- relevant bei Schizophrenie105
- D1 / Histamin-H3-Heteromer105
- relevant bei ADHS, Sucht, Schizophrenie105
- D2 / Histamin-H3-Heteromer105
- relevant bei ADHS, Sucht, Schizophrenie105
- D2 / Glutamat-NMDA-Heteromere10
- D3 / Glutamat-NMDA-Heteromere10
7.8. Hochaffiner und niedrigaffiner Rezeptorstatus
Für Dopaminrezeptoren wird ein hochaffiner und ein niedrigaffiner Zustand berichtet (hig affinity state / low affinity state).108115
Der hochaffine Zustand ist der funktionale Zustand für D1- wie für D2-Rezeptoren. Stimulanzien könnendas Gleichgewicht zwischen dem Zustand hoher und niedriger Affinität verändern, indem sie den extrazellulären Spiegel von Dopamin erhöhen.116
Der D2-Rezeptor wird im High-Zustand durch etwa 10 nM Dopamin zu 50 % besetzt.117
Der D2-High-Rezeptor-State im Hypophysenvorderlappen kann vollständig in den D2-low-state umgewandelt werden. Die Umwandlung im Gehirngewebe scheint vom Vorhandensein von Serotoninrezeptoren abzuhängen, wie im Striatum der Ratte oder im menschlichen Nucleus accumbens, in dem sich nur sehr wenige Serotoninrezeptoren finden.118
7.9. Dopamin - Spare Rezeptoren / Rezeptor Reserve?
Unter Rezeptorreserve (Spare Rezeptoren) versteht man das Phänomen, dass ein Agonist die maximale Reaktion hervorruft, indem er nur einen Bruchteil der im System vorhandenen Rezeptorpopulation aktiviert.119
Über Dopamin Spare Rezeptoren gibt es bislang nur wenig Informationen.115
7.10. G-Protein-unabhängige Dopaminrezeptoraktivierung
Dopamin-Rezeptoren können auch durch Mechanismen aktiviert werden, die von G-Proteinen unabhängig sind:3
Das multifunktionale Adaptorprotein Arrestin kann von GPCR-Kinasen (GRKs) phosphorylierte DA-Rezeptoren binden und mehrere Proteine rekrutieren, darunter
- Akt
- GSK-3
- MAPK
- c-Src
- Mdm2
- N-Ethylmaleimid-sensitiver Faktor.
Bindet Arrestin an aktive phosphorylierte Rezeptoren, wird die weitere Aktivierung von G-Proteinen gestoppt und die Endozytose des Rezeptors gefördert.
Dopamin-Rezeptoren werden weiterhin durch G-Protein-gekoppelte Rezeptorkinasen (GRKs) reguliert.
Bei Säugetieren gibt es sieben GRKs:
D1R und D2R regulieren GRK2, 3, 4, 5, 6
D3R wird kontrolliert von GRK4.
Im Striatum werden die GRKs 2, 3, 5 und 6 mit unterschiedlichen Expressionsniveaus und unterschiedlicher zellulärer und subzellulärer Verteilung exprimiert.120
Eine DA-Läsion mit 6-Hydroxydopamin führte zu multiplen protein- und hirnregionenspezifischen Veränderungen in der Expression von GRKs. Reduziert waren:121
- im Globus pallidus:
- reduziert: GRK2, 3, 5, 6
- kaudales Caudat-Putamen:
- reduziert: GRK2, 3, 6
- rostralen Caudate-Putamen:
- reduziert: GRK3
- erhöht: GRK6
- erhöht durch nachfolgendes L-Dopa: GRK2
- Nucleus accumbens
- erhöht: GRK6
Diese Veränderungen blieben durch nachfolgendes L-DOPA unverändert und wurden durch den D2/D3-Agonist Pergolid aufgehoben. L-Dopa regulierte GRK5 herunter.
Nachfolgendes L-DOPA beeinflusste die Expression von Arrestin3.
- erhöht: GRK6
7.11. Dopamin-Agonisten und -Antagonisten
7.11.1. Dopamin-Agonisten
- ADTN (2-Amino-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalinhydrobromid)122
- Apomorphin66
- FAUC 17966
- Budipin, 1-tert-Butyl-4,4-diphenylpiperidin
- Dopaminrezeptor-Agonist
- NMDA-Rezeptor-Antagonist
- MAO-Hemmer-Antagonist
- schwache anticholinerge Wirkung
- Cabergolin, 1-[(6-Allylergolin-8beta-yl)carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylharnstoff; 1[(6-Allyl-8-Beta-ergolinyl)carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N-[(ethylamino)carbonyl]-6-(prop-2-enyl)-8beta-ergolin-8-carboxamid
- Dopaminrezeptor-Agonist
- Prolaktin-Antagonist
- Dihydroergocryptin, 9,10-Dihydro-12-hydroxy-2-isopropyl-5 alpha-(2-methylpropyl)ergotaman-3,6,18-trion
- Dopaminrezeptor-Agonist
- Levodopa
- Dopamin / Noradrenalin / Adrenalin – Prodrug
- Carbidopa
- Lisurid, 1,1-Diethyl-3-(6-methyl-9,10-didehydroergolin-8alpha-yl)harnstoff
- Dopaminrezeptor-Agonist
- Prolaktin-Antagonist
- Einfluss auf Wachstumshormon
- Pergolid, 8beta-(Methylthiomethyl)-6-propylergolin
- Dopaminrezeptor-Agonist
- Piribedil, 2-[4-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]pyrimidin. Piperazidin. Piprazidin
- Dopaminrezeptor-Agonist
- Acetylcholinrezeptor-Antagonist
- Pramipexol, (S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)benzothiazol. (S)-2-Amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol
- D3-Dopaminrezeptor-Agonist66
- Ropinirol, 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]indolin-2-on
- D3-Dopaminrezeptor-Agonist66
- 5,6,7,8-Tetrahydro-6-(2-propen-1-yl)-4H-thiazolo[4,5-d]azepin-2-amin Dihydrochlorid (BHT-920)
- D2-Agonist123
7.11.2. Indirekte Dopamin-Rezeptor-Agonisten
Indirekte Dopamin-Rezeptor-Agonisten erhöhen (über verschiedene Mechanismen) die Aktivität des mesolimbischen dopaminergen Systems:
7.11.3. Dopamin-Antagonisten
- Paliperidon, (RS)-3-{2-[4-(6-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidino]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on; 9-Hydroxy-Risperidon
- Dopamin-Antagonist
- Noradrenalin-Antagonist
- Adrenalin-Antagonist
- Serotonin-Antagonist
- Histamin-Antagonist
- Adenosin
- Dopamin-Hemmer
7.11.4. Rezeptorbindung von Dopamin-Agonisten und -Antagonisten
Die Angaben sind in Ki in nM. Je niedriger der Wert, desto höher die Rezeptorbindung.
Größer als 10.000 wurde auch für “keine Bindung” angegeben.
Basierend auf Melis et al.124 und Zhou et al.125
Differierende Werte verschiedener Quellen sind durch “;” getrennt.
| Agonist | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dopamin | 0,9 - 2.340 | 2,8 - 474 | 4 - 27 | 28 - 450; 11,6 (D4-2); 56,2 (D4-4); 9,8 (D4-7) | < 0,9 - 261 |
| Apomorphin | 0,7 - 680 | 32; 0,7 - 24 | 26; 20 - 32 | 2,6; 4; 1,1 (D4-2); 4,0 (D4-4); 1,2 (D4-7) | 122 - 168 |
| ADTN | 2,9 - >10.000 | 1 - 1.370 | 393 | ||
| Quinpirol | 1,8 | 0,96 | 3 | ||
| Pramipexol | 3,9 | 0,5 | 5,1 | ||
| PD 128.907 | 931 | 9,7 | 2430 | ||
| ABT-724 | >10.000 | >10.000 | >10.000 | 57,5 (D4-2); 63,6 (D4-4); 46,8 (D4-7) | >10.000 |
| PIP-3EA | 990 | 3.900 | 2,8 | ||
| FAUC 3019 | 33 | 82 | 0,4 | ||
| A-412997 | 2.848 | 2.095 | 7,9 | ||
| CP 226269 | 1.760 | 6,0 | |||
| SKF 38393 | 1 - 150 | 150 - 9.560 | 5.000 | 1.000 - 1.300 | 0,5 - 100 |
| PD 168077 | >10.000 | 2.820 - 3.740 | 2.810 | 8,7 - 25 |
Die Angaben sind in Ki in nM. Je niedriger der Wert, desto höher die Rezeptorbindung.
Differierende Werte verschiedener Quellen sind durch “;” getrennt.
| Antagonist | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|
| L-741,626 | 2,4 | 100 | 200 | ||
| SB277011A | 1000 | 10 | |||
| FAUC 365 | 3600 | 0,5 | 340 | ||
| L-745870 | 960 | 2.300 | 0,43 | ||
| Haloperidol | 27 - 203 | 0,6 - 1,2; 6,3 | 2,74 - 7,8; 6,1 | 2,3 - 5,1; 10 | 33 - 151 |
| Racloprid | 1 | 1,3 | 5070 | ||
| Spiperon | 99 - 350 | 0,06 - 0,37 | 0,43 - 0,71 | 0,05 - 4 | 135 - 4.500 |
| SCH 23390 | 0,11 - 0,35 | 270 - 1.100 | 314 - 800 | 3.000 - 3.560 | 0,11 - 0,54 |
| Sulpirid | 20.400 - 45.000 | 2,5 - 7,1 | 8 - 206 | 21 - 1.000 | 11.000 - 77.270 |
7.12. Beeinflussung der Dopaminsignalisierung durch Beeinflussung der Second Messenger
Die Dopamin-Signalübertragung wird maßgeblich durch zyklische Nukleotid-Signalwege beeinflusst. Diese wiederum unterliegen Einflussfaktoren, dii damit mittelbar die Dopaminsignalisierung beeinflussen:10126127
- Synthese durch Adenylatzyklasen und Guanylatzyklasen
- Aktivierung oder Hemmung der cAMP-Signalübertragung wird beeinflusst durch
- Rezeptorkonfigurationen
- Expression nachgeschalteter Komponenten
- Proteinregulation der nachgeschalteten Komponenten
7.12.1. Phosphodiesterasen (PDEs)
- Abbau durch Phosphodiesterasen (PDEs)
- PDEs werden als Wirkstoffziele erforscht128129130
- einer der bekanntesten Anwendungsfälle sind PDE5-Inhibitoren bei Erektionsproblemen131
- PDEs von Säugetieren: Superfamilie von 11 Mitgliedern, die aus 21 verschiedenen Genen stammen, aus denen > 100 verschiedene Isoformen hervorgehen13210
- PDEs werden in verschiedenen Geweben unterschiedlich exprimiert133
- PDEs unterscheiden sich nach
- Substratselektivität (gegenüber cAMP und cGMP)
- Regulation
- zellulärer Lokalisierung
- im Striatum insbesondere PDE1, PDE2, PDE4 und PDE10126
- PDEs werden als Wirkstoffziele erforscht128129130
7.12.1.1. PDE1B
- PDE1B10
7.12.1.2. PDE2A
- PDE2A 10
- durch cGMP-aktiviert, das zugleich cAMP senkt
- findet sich hauptsächlich in
- axonalen und terminalen Kompartimenten
- der Pyramidenneuronen im Kortex und Hippocampus
- MSN des Striatums
- mediale Habenula
- in Terminalen von
- Globus pallidus
- Substantia nigra pars reticulata
- Nucleus interpeduncularis
- axonalen und terminalen Kompartimenten
- trägt in Terminalen zur Stickstoffmonoxid-vermittelten Hemmung der präsynaptischen Aktivität bei
7.12.1.3. PDE4
- PDE4
7.12.1.4. PDE10A
- PDE10A10
- in den mittelgroßen stacheligen Neuronen (MSN) des Striatums stark exprimiert
- hohe Affinität zu cAMP
- wichtig für die Aufrechterhaltung der cAMP-Grundkonzentration und der PKA-Aktivität in striatalen MSN
- PDE10A-KO-Mäuse sollen verringerte Bewegungsaktivität und Amphetaminempfindlichkeit zeigen10
- PDE10A-Inhibitoren wirken D2-antagonistisch127
7.13. D2 und D3-Rezeptoren bei ADHS verringert?
ADHS-Betroffene haben nach Volkow et al. weniger D2/D3-Rezeptoren als Nichtbetroffene:
- im Hypothalamus: 58 % weniger
- im Mittelhirn: 36 % weniger
- im Nucleus caudatus: 12 % weniger
- im Nucleus accumbens: 6 % weniger
Liu, Goel, Kaeser (2021): Spatial and temporal scales of dopamine transmission. Nat Rev Neurosci. 2021 Jun;22(6):345-358. doi: 10.1038/s41583-021-00455-7. PMID: 33837376; PMCID: PMC8220193. ↥ ↥
Müller (2007): Dopamin und kognitive Handlungssteuerung: Flexibilität und Stabilität in einem Set-Shifting Paradigma. Dissertation. ↥
Speranza, di Porzio, Viggiano, de Donato, Volpicelli (2021): Dopamine: The Neuromodulator of Long-Term Synaptic Plasticity, Reward and Movement Control. Cells. 2021 Mar 26;10(4):735. doi: 10.3390/cells10040735. PMID: 33810328; PMCID: PMC8066851. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥
Gatzke-Kopp, Beauchaine (2007): Central nervous system substrates of impulsivity: Implications for the development of attention-deficit/hyperactivity disorder and conduct disorder. In: Coch, Dawson, Fischer ( Eds): Human behavior, learning, and the developing brain: Atypical development. New York: Guilford Press; 2007. pp. 239–263; 245 ↥
Condon AF, Robinson BG, Asad N, Dore TM, Tian L, Williams JT (2021): The residence of synaptically released dopamine on D2 autoreceptors. Cell Rep. 2021 Aug 3;36(5):109465. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109465. PMID: 34348146; PMCID: PMC8351352. ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Edel, Vollmoeller (2006): ADHS bei Erwachsenen, Seite 112 ↥
Araki, Sims, Bhide (2007): Dopamine receptor mRNA and protein expression in the mouse corpus striatum and cerebral cortex during pre- and postnatal development. Brain Res. 2007 Jul 2;1156:31-45. doi: 10.1016/j.brainres.2007.04.043. PMID: 17509542; PMCID: PMC1994791. ↥
Perreault, Hasbi, O’Dowd, George (2014): Heteromeric dopamine receptor signaling complexes: emerging neurobiology and disease relevance. Neuropsychopharmacology. 2014 Jan;39(1):156-68. doi: 10.1038/npp.2013.148. PMID: 23774533; PMCID: PMC3857642. ↥
Ijomone OK, Oria RS, Ijomone OM, Aschner M, Bornhorst J (2025): Dopaminergic Perturbation in the Aetiology of Neurodevelopmental Disorders. Mol Neurobiol. 2025 Feb;62(2):2420-2434. doi: 10.1007/s12035-024-04418-8. PMID: 39110391; PMCID: PMC11772124. REVIEW ↥
MacDonald HJ, Kleppe R, Szigetvari PD, Haavik J (2024): The dopamine hypothesis for ADHD: An evaluation of evidence accumulated from human studies and animal models. Front Psychiatry. 2024 Nov 15;15:1492126. doi: 10.3389/fpsyt.2024.1492126. PMID: 39619336; PMCID: PMC11604610. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Myslivecek (2022): Dopamine and Dopamine-Related Ligands Can Bind Not Only to Dopamine Receptors. Life (Basel). 2022 Apr 19;12(5):606. doi: 10.3390/life12050606. PMID: 35629274; PMCID: PMC9147915. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Giertler (2003): Die Rolle des Nucleus accumbens bei der Akquisition und Expression von instrumentellem Verhalten der Ratte, Dissertation ↥
Bonaventura, Quiroz, Cai, Rubinstein, Tanda, Ferré (2017): Key role of the dopamine D4 receptor in the modulation of corticostriatal glutamatergic neurotransmission. Sci Adv. 2017 Jan 11;3(1):e1601631. doi: 10.1126/sciadv.1601631. eCollection 2017 Jan. ↥
Broome, Louangaphay, Keay, Leggio, Musumeci, Castorina (2020): Dopamine: an immune transmitter. Neural Regen Res. 2020 Dec;15(12):2173-2185. doi: 10.4103/1673-5374.284976. PMID: 32594028; PMCID: PMC7749467. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Martel JC, Gatti McArthur S (2020): Dopamine Receptor Subtypes, Physiology and Pharmacology: New Ligands and Concepts in Schizophrenia. Front Pharmacol. 2020 Jul 14;11:1003. doi: 10.3389/fphar.2020.01003. PMID: 32765257; PMCID: PMC7379027. REVIEW ↥
Hunger L, Kumar A, Schmidt R (2020): Abundance Compensates Kinetics: Similar Effect of Dopamine Signals on D1 and D2 Receptor Populations. J Neurosci. 2020 Apr 1;40(14):2868-2881. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1951-19.2019. PMID: 32071139; PMCID: PMC7117896. ↥
Caravaggio F, Iwata Y, Kim J, Shah P, Gerretsen P, Remington G, Graff-Guerrero A (2020): What proportion of striatal D2 receptors are occupied by endogenous dopamine at baseline? A meta-analysis with implications for understanding antipsychotic occupancy. Neuropharmacology. 2020 Feb;163:107591. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.03.034. PMID: 30940535. METASTUDY ↥
Meador-Woodruff JH (1994): Update on dopamine receptors. Ann Clin Psychiatry. 1994 Jun;6(2):79-90. doi: 10.3109/10401239409148986. PMID: 7804392. ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Meador-Woodruff, Damask, Wang, Haroutunian, Davis, Watson (1996): Dopamine receptor mRNA expression in human striatum and neocortex. Neuropsychopharmacology. 1996 Jul;15(1):17-29. doi: 10.1016/0893-133X(95)00150-C. PMID: 8797188. ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Beaulieu JM, Gainetdinov RR (2011): The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors. Pharmacol Rev. 2011 Mar;63(1):182-217. doi: 10.1124/pr.110.002642. PMID: 21303898. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Stahl (2000): Essential Psychopharmacology, Neuroscientific Basis and Practical Applications. Second Edition, Cambridge University Press; zitiert nach Franck (2003): Hyperaktivität und Schizophrenie – eine explorative Studie; Dissertation, Seite 66 ↥
Hunger L, Kumar A, Schmidt R (2020): Abundance Compensates Kinetics: Similar Effect of Dopamine Signals on D1 and D2 Receptor Populations. J Neurosci. 2020 Apr 1;40(14):2868-2881. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1951-19.2019. Epub 2020 Feb 18. PMID: 32071139; PMCID: PMC7117896. ↥
Pereira, Sulzer (2012): Mechanisms of dopamine quantal size regulation. Front Biosci (Landmark Ed). 2012 Jun 1;17(7):2740-67. doi: 10.2741/4083. PMID: 22652810. REVIEW ↥
Yung KK, Bolam JP, Smith AD, Hersch SM, Ciliax BJ, Levey AI (1995): Immunocytochemical localization of D1 and D2 dopamine receptors in the basal ganglia of the rat: light and electron microscopy. Neuroscience. 1995 Apr;65(3):709-30. doi: 10.1016/0306-4522(94)00536-e. PMID: 7609871. ↥
Cragg SJ, Rice ME (2004): DAncing past the DAT at a DA synapse. Trends Neurosci. 2004 May;27(5):270-7. doi: 10.1016/j.tins.2004.03.011. PMID: 15111009. ↥
In der von Seamans JK, Yang CR (2004): The principal features and mechanisms of dopamine modulation in the prefrontal cortex. Prog Neurobiol. 2004 Sep;74(1):1-58. doi: 10.1016/j.pneurobio.2004.05.006. Erratum in: Prog Neurobiol. 2004 Dec;74(5):321. PMID: 15381316., REVIEW, angegebenen Quelle,Pickel VM, Beckley SC, Joh TH, Reis DJ (1981): Ultrastructural immunocytochemical localization of tyrosine hydroxylase in the neostriatum. Brain Res. 1981 Nov 30;225(2):373-85. doi: 10.1016/0006-8993(81)90843-x. PMID: 6118197., nicht verifizierbar. ↥
Wightman RM, Zimmerman JB (1990): Control of dopamine extracellular concentration in rat striatum by impulse flow and uptake. Brain Res Brain Res Rev. 1990 May-Aug;15(2):135-44. doi: 10.1016/0165-0173(90)90015-g. PMID: 2282449. REVIEW ↥
Garris PA, Wightman RM (1994): Different kinetics govern dopaminergic transmission in the amygdala, prefrontal cortex, and striatum: an in vivo voltammetric study. J Neurosci. 1994 Jan;14(1):442-50. doi: 10.1523/JNEUROSCI.14-01-00442.1994. PMID: 8283249; PMCID: PMC6576851. ↥ ↥
Gonon F (1997): Prolonged and extrasynaptic excitatory action of dopamine mediated by D1 receptors in the rat striatum in vivo. J Neurosci. 1997 Aug 1;17(15):5972-8. doi: 10.1523/JNEUROSCI.17-15-05972.1997. PMID: 9221793; PMCID: PMC6573191. ↥
Ruskin DN, Bergstrom DA, Shenker A, Freeman LE, Baek D, Walters JR (2001): Drugs used in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder affect postsynaptic firing rate and oscillation without preferential dopamine autoreceptor action. Biol Psychiatry. 2001 Feb 15;49(4):340-50. doi: 10.1016/s0006-3223(00)00987-2. PMID: 11239905. ↥ ↥
Undieh (2010): Pharmacology of signaling induced by dopamine D(1)-like receptor activation. Pharmacol Ther. 2010 Oct;128(1):37-60. doi: 10.1016/j.pharmthera.2010.05.003. PMID: 20547182; PMCID: PMC2939266. ↥
Ford CP (2014): The role of D2-autoreceptors in regulating dopamine neuron activity and transmission. Neuroscience. 2014 Dec 12;282:13-22. doi: 10.1016/j.neuroscience.2014.01.025. PMID: 24463000; PMCID: PMC4108583. REVIEW ↥ ↥ ↥
Gurevich, Gainetdinov, Gurevich (2016): G protein-coupled receptor kinases as regulators of dopamine receptor functions. Pharmacol Res. 2016 Sep;111:1-16. doi: 10.1016/j.phrs.2016.05.010. PMID: 27178731; PMCID: PMC5079267. ↥
Levy F (2009): Dopamine vs noradrenaline: inverted-U effects and ADHD theories. Aust N Z J Psychiatry. 2009 Feb;43(2):101-8. doi: 10.1080/00048670802607238. PMID: 19153917. REVIEW ↥ ↥
Jaber, Robinson, Missale, Caron (1996): Dopamine receptors and brain function; Neuropharmacology; Volume 35, Issue 11, 1996, Pages 1503-1519; https://doi.org/10.1016/S0028-3908(96)00100-1 ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Gonon F, Burie JB, Jaber M, Benoit-Marand M, Dumartin B, Bloch B (2000): Geometry and kinetics of dopaminergic transmission in the rat striatum and in mice lacking the dopamine transporter. Prog Brain Res. 2000;125:291-302. doi: 10.1016/S0079-6123(00)25018-8. PMID: 11098665. ↥
Stuckenholz (2013): Die Effekte des α7-nikotinergen Acetylcholin-Agonisten PNU-282987 und des nikotinergen Acetylcholin-Antagonisten Mecamylamin auf Neuroinflammation und Neurodegeneration im akuten MPTP-Mausmodell des Morbus Parkinson, Dissertation ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Brusniak MY, Pearlman RS, Neve KA, Wilcox RE (1996): Comparative molecular field analysis-based prediction of drug affinities at recombinant D1A dopamine receptors. J Med Chem. 1996 Feb 16;39(4):850-9. doi: 10.1021/jm950447w. PMID: 8632409. ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Centonze, Grande, Saulle, Martin, Gubellini, Pavón, Pisani, Bernardi, Moratalla, Calabresi (2003): Distinct roles of D1 and D5 dopamine receptors in motor activity and striatal synaptic plasticity. J Neurosci. 2003 Sep 17;23(24):8506-12. doi: 10.1523/JNEUROSCI.23-24-08506.2003. PMID: 13679419; PMCID: PMC6740372. ↥ ↥
Weele, Siciliano, Tye (2018): Dopamine tunes prefrontal outputs to orchestrate aversive processing. Brain Res. 2018 Dec 1. pii: S0006-8993(18)30610-3. doi: 10.1016/j.brainres.2018.11.044. Seite 31 ↥ ↥ ↥
Caine SB, Thomsen M, Gabriel KI, Berkowitz JS, Gold LH, Koob GF, Tonegawa S, Zhang J, Xu M (2007): Lack of self-administration of cocaine in dopamine D1 receptor knock-out mice. J Neurosci. 2007 Nov 28;27(48):13140-50. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2284-07.2007. PMID: 18045908; PMCID: PMC2747091. ↥
Ellenbroek BA (2013): Histamine H₃ receptors, the complex interaction with dopamine and its implications for addiction. Br J Pharmacol. 2013 Sep;170(1):46-57. doi: 10.1111/bph.12221. PMID: 23647606; PMCID: PMC3764848. REVIEW ↥
Franck (2003): Hyperaktivität und Schizophrenie – eine explorative Studie; Dissertation, unter Verweis auf Seeman 1987 ↥ ↥
Reinel (2015): Multidisziplinäre Untersuchung dopaminerger Mechanismen der repetitiven Störungen anhand von zwei Rattenmodellen dopaminerger Dysregulation, Dissertation ↥ ↥
Schoffelmeer, De Vries, Vanderschuren, Tjon, Nestby, Wardeh, Mulder (1997): Intermittent morphine administration induces a long-lasting synergistic effect of corticosterone on dopamine D1 receptor functioning in rat striatal GABA neurons. Synapse. 1997 Apr;25(4):381-8. doi: 10.1002/(SICI)1098-2396(199704)25:4<381::AID-SYN9>3.0.CO;2-6. PMID: 9097397. ↥
Schoffelmeer, De Vries, Vanderschuren, Tjon, Nestby, Wardeh, Mulder (1995): Glucocorticoid receptor activation potentiates the morphine-induced adaptive increase in dopamine D-1 receptor efficacy in gamma-aminobutyric acid neurons of rat striatum/nucleus accumbens. J Pharmacol Exp Ther. 1995 Sep;274(3):1154-60. PMID: 7562482. ↥
Gariépy, Gendreau, Cairns, Lewis (1998): D1 dopamine receptors and the reversal of isolation-induced behaviors in mice. Behav Brain Res. 1998 Sep;95(1):103-11. doi: 10.1016/s0166-4328(97)00215-5. PMID: 9754882. ↥
Gariépy, Gendreau, Mailman, Tancer, Lewis (1995): Rearing conditions alter social reactivity and D1 dopamine receptors in high- and low-aggressive mice. Pharmacol Biochem Behav. 1995 Aug;51(4):767-73. doi: 10.1016/0091-3057(95)00028-u. PMID: 7675857. ↥
Missale, Nash, Robinson, Jaber, Caron (1998): Dopamine receptors: from structure to function. Physiol Rev. 1998 Jan;78(1):189-225. doi: 10.1152/physrev.1998.78.1.189. PMID: 9457173. REVIEW ↥
Interview mit John-Dylan Haynes in Technologie Report Heft 04 2016, Seite 46 ↥
Sánchez-Soto, Bonifazi, Cai, Ellenberger, Newman, Ferré, Yano (2016): Evidence for Noncanonical Neurotransmitter Activation: Norepinephrine as a Dopamine D2-Like Receptor Agonist. Mol Pharmacol. 2016 Apr;89(4):457-66. doi: 10.1124/mol.115.101808. ↥ ↥ ↥ ↥
Khan, Mrzljak, Gutierrez, de la Calle, Goldman-Rakic (1998): Prominence of the dopamine D2 short isoform in dopaminergic pathways. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Jun 23;95(13):7731-6. doi: 10.1073/pnas.95.13.7731. PMID: 9636219; PMCID: PMC22740. ↥
Mlost J, Wąsik A, Starowicz K (2019): Role of endocannabinoid system in dopamine signalling within the reward circuits affected by chronic pain. Pharmacol Res. 2019 May;143:40-47. doi: 10.1016/j.phrs.2019.02.029. PMID: 30831242. REVIEW mit Verweis auf Zawilska J, Dziedzicka-Wasylewska M (2004): Receptory dopaminowe. In: Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału, 2004, pp. 274–304. ↥ ↥ ↥
Lee, Pei, Moszczynska, Vukusic, Fletcher, Liu (2007): Dopamine transporter cell surface localization facilitated by a direct interaction with the dopamine D2 receptor. EMBO J. 2007;26(8):2127–2136. doi:10.1038/sj.emboj.7601656 ↥ ↥ ↥ ↥
Usiello A, Baik JH, Rougé-Pont F, Picetti R, Dierich A, LeMeur M, Piazza PV, Borrelli E (2000): Distinct functions of the two isoforms of dopamine D2 receptors. Nature. 2000 Nov 9;408(6809):199-203. doi: 10.1038/35041572. PMID: 11089973. ↥ ↥
Marcott, Gong, Donthamsetti, Grinnell, Nelson, Newman, Birnbaumer, Martemyanov, Javitch, Ford (2018): Regional Heterogeneity of D2-Receptor Signaling in the Dorsal Striatum and Nucleus Accumbens. Neuron. 2018 May 2;98(3):575-587.e4. doi: 10.1016/j.neuron.2018.03.038. PMID: 29656874; PMCID: PMC6048973. ↥
Marcott, Mamaligas, Ford (2014): Phasic dopamine release drives rapid activation of striatal D2-receptors. Neuron. 2014 Oct 1;84(1):164-176. doi: 10.1016/j.neuron.2014.08.058. PMID: 25242218; PMCID: PMC4325987. ↥
Sulzer, Cragg, Rice (2016): Striatal dopamine neurotransmission: regulation of release and uptake. Basal Ganglia. 2016 Aug;6(3):123-148. doi: 10.1016/j.baga.2016.02.001. PMID: 27141430; PMCID: PMC4850498. ↥
Beckstead, Grandy, Wickman, Williams (2004): Vesicular dopamine release elicits an inhibitory postsynaptic current in midbrain dopamine neurons. Neuron. 2004 Jun 24;42(6):939-46. doi: 10.1016/j.neuron.2004.05.019. PMID: 15207238. ↥
Drukarch B, Stoof JC (1990): D-2 dopamine autoreceptor selective drugs: do they really exist? Life Sci. 1990;47(5):361-76. doi: 10.1016/0024-3205(90)90293-z. PMID: 1975636. REVIEW ↥
Graff-Guerrero A, Mizrahi R, Agid O, Marcon H, Barsoum P, Rusjan P, Wilson AA, Zipursky R, Kapur S (2009): The dopamine D2 receptors in high-affinity state and D3 receptors in schizophrenia: a clinical [11C]-(+)-PHNO PET study. Neuropsychopharmacology. 2009 Mar;34(4):1078-86. doi: 10.1038/npp.2008.199. PMID: 18987627. ↥
Chiodo LA, Bannon MJ, Grace AA, Roth RH, Bunney BS (1984): Evidence for the absence of impulse-regulating somatodendritic and synthesis-modulating nerve terminal autoreceptors on subpopulations of mesocortical dopamine neurons. Neuroscience. 1984 May;12(1):1-16. doi: 10.1016/0306-4522(84)90133-7. PMID: 6462443. ↥
Lammel S, Hetzel A, Häckel O, Jones I, Liss B, Roeper J (2008): Unique properties of mesoprefrontal neurons within a dual mesocorticolimbic dopamine system. Neuron. 2008 Mar 13;57(5):760-73. doi: 10.1016/j.neuron.2008.01.022. PMID: 18341995. ↥
Frank (2005): Synthese von dualen NMDA-Rezeptor-/Dopamin-Rezeptor-Liganden, Dissertation, Seite 31 ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Frank (2005): Synthese von dualen NMDA-Rezeptor-/Dopamin-Rezeptor-Liganden, Dissertation, Seite 33 ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Wolf, Calabrese (2020): Stressmedizin & Stresspsychologie; Seite 302 ↥
Böhm (2020): Dopaminerge Systeme, in: Freissmuth, Offermanns, Böhm (Herausgeber): Pharmakologie und Toxikologie. Von den molekularen Grundlagen zur Pharmakotherapie. ↥
Franck (2003): Hyperaktivität und Schizophrenie – eine explorative Studie; Dissertation, unter Verweis auf Anderson und Teicher, 2000 ↥
Rinne, Hietala, Ruotsalainen, Säkö, Laihinen, Någren, Lehikoinen, Oikonen, Syvälahti (1993): Decrease in human striatal dopamine D2 receptor density with age: a PET study with [11C]raclopride. J Cereb Blood Flow Metab. 1993 Mar;13(2):310-4. doi: 10.1038/jcbfm.1993.39. PMID: 8436624. ↥
Rosa-Neto, Lou, Cumming, Pryds, Karrebaek, Lunding, Gjedde (2005): Methylphenidate-evoked changes in striatal dopamine correlate with inattention and impulsivity in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Neuroimage. 2005 Apr 15;25(3):868-76. doi: 10.1016/j.neuroimage.2004.11.031. PMID: 15808987. n = 9 ↥
Nishino, Sakai (2016): Modulations of Ventral Tegmental Area (VTA) Dopaminergic Neurons by Hypocretins/Orexins: Implications in Vigilance and Behavioral Control In: Monti, Pandi-Perumal, Chokroverty (Herausgeber) (2016): Dopamine and Sleep: Molecular, Functional, and Clinical Aspects, 65-90, 74 ↥ ↥ ↥ ↥
Ferré S, Belcher AM, Bonaventura J, Quiroz C, Sánchez-Soto M, Casadó-Anguera V, Cai NS, Moreno E, Boateng CA, Keck TM, Florán B, Earley CJ, Ciruela F, Casadó V, Rubinstein M, Volkow ND (2022): Functional and pharmacological role of the dopamine D4 receptor and its polymorphic variants. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Sep 30;13:1014678. doi: 10.3389/fendo.2022.1014678. PMID: 36267569; PMCID: PMC9578002. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Genro JP, Kieling C, Rohde LA, Hutz MH (2010): Attention-deficit/hyperactivity disorder and the dopaminergic hypotheses. Expert Rev Neurother. 2010 Apr;10(4):587-601. doi: 10.1586/ern.10.17. PMID: 20367210. ↥
Faraone SV, Perlis RH, Doyle AE, Smoller JW, Goralnick JJ, Holmgren MA, Sklar P. Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 2005 Jun 1;57(11):1313-23. doi: 10.1016/j.biopsych.2004.11.024. PMID: 15950004. REVIEW ↥
Koevoet D, Deschamps PKH, Kenemans JL (2023): Catecholaminergic and cholinergic neuromodulation in autism spectrum disorder: A comparison to attention-deficit hyperactivity disorder. Front Neurosci. 2023 Jan 6;16:1078586. doi: 10.3389/fnins.2022.1078586. PMID: 36685234; PMCID: PMC9853424. REVIEW ↥
Frank (2005): Synthese von dualen NMDA-Rezeptor-/Dopamin-Rezeptor-Liganden, Dissertation, Seite 34 ↥ ↥ ↥
Rubinstein M, Cepeda C, Hurst RS, Flores-Hernandez J, Ariano MA, Falzone TL, Kozell LB, Meshul CK, Bunzow JR, Low MJ, Levine MS, Grandy DK (2001): Dopamine D4 receptor-deficient mice display cortical hyperexcitability. J Neurosci. 2001 Jun 1;21(11):3756-63. doi: 10.1523/JNEUROSCI.21-11-03756.2001. PMID: 11356863; PMCID: PMC6762699. ↥
Bonaventura J, Quiroz C, Cai NS, Rubinstein M, Tanda G, Ferré S (2017): Key role of the dopamine D4 receptor in the modulation of corticostriatal glutamatergic neurotransmission. Sci Adv. 2017 Jan 11;3(1):e1601631. doi: 10.1126/sciadv.1601631. PMID: 28097219; PMCID: PMC5226642. ↥
Avale ME, Falzone TL, Gelman DM, Low MJ, Grandy DK, Rubinstein M (2004); The dopamine D4 receptor is essential for hyperactivity and impaired behavioral inhibition in a mouse model of attention deficit/hyperactivity disorder. Mol Psychiatry. 2004 Jul;9(7):718-26. doi: 10.1038/sj.mp.4001474. PMID: 14699433. ↥
Roessner, Rothenberger (2020): Neurochemie, S. 94, in Steinhausen, Rothenberger, Döpfner (Herausgeber): Handbuch ADHS; Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Kohlhammer ↥
Iversen L, Iversen F, Bloom S, Roth R (2009): Introduction to Neuropsychopharmacology, S. 205 ↥ ↥ ↥
Klitten LL, Rath MF, Coon SL, Kim JS, Klein DC, Møller M (2008): Localization and regulation of dopamine receptor D4 expression in the adult and developing rat retina. Exp Eye Res. 2008 Nov;87(5):471-7. doi: 10.1016/j.exer.2008.08.004. PMID: 18778704; PMCID: PMC2597030. ↥
Kim JS, Bailey MJ, Weller JL, Sugden D, Rath MF, Møller M, Klein DC (2010): Thyroid hormone and adrenergic signaling interact to control pineal expression of the dopamine receptor D4 gene (Drd4). Mol Cell Endocrinol. 2010 Jan 15;314(1):128-35. doi: 10.1016/j.mce.2009.05.013. PMID: 19482058; PMCID: PMC2783391. ↥
Ferré S, Belcher AM, Bonaventura J, Quiroz C, Sánchez-Soto M, Casadó-Anguera V, Cai NS, Moreno E, Boateng CA, Keck TM, Florán B, Earley CJ, Ciruela F, Casadó V, Rubinstein M, Volkow ND (2022): Functional and pharmacological role of the dopamine D4 receptor and its polymorphic variants. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Sep 30;13:1014678. doi: 10.3389/fendo.2022.1014678. PMID: 36267569; PMCID: PMC9578002. ↥
Chang FM, Kidd JR, Livak KJ, Pakstis AJ, Kidd KK (1996): The world-wide distribution of allele frequencies at the human dopamine D4 receptor locus. Hum Genet. 1996 Jul;98(1):91-101. doi: 10.1007/s004390050166. PMID: 8682515. ↥
Einsiedel, Hübner, Gmeiner (2001): Benzamide bioisosteres incorporating dihydroheteroazole substructures: EPC synthesis and SAR leading to a selective dopamine D4 receptor partial agonist (FAUC 179), Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 11, Issue 18, 17 September 2001, Pages 2533-2536 https://doi.org/10.1016/S0960-894X(01)00484-XII ↥
Raviña, Casariego, Masaguer, Fontenla, Montenegro, Rivas, Loza, Enguix, Villazon, Cadavid, Demontis (2000): Conformationally Constrained Butyrophenones with Affinity for Dopamine (D1, D2, D4) and Serotonin (5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C) Receptors: Synthesis of Aminomethylbenzo[b]furanones and Their Evaluation as Antipsychotics; Journal of Medicinal Chemistry 2000 43 (24), 4678-4693; DOI: 10.1021/jm0009890 ↥
Thörn CW, Kafetzopoulos V, Kocsis B (2022): Differential Effect of Dopamine D4 Receptor Activation on Low-Frequency Oscillations in the Prefrontal Cortex and Hippocampus May Bias the Bidirectional Prefrontal-Hippocampal Coupling. Int J Mol Sci. 2022 Oct 3;23(19):11705. doi: 10.3390/ijms231911705. PMID: 36233007; PMCID: PMC9569525. ↥
Cooper, Bloom, Roth (2003): The biochemical Basis of Neuropharmacology, 8. Edition, S. 243 ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Riederer P, Laux G, Pöldinger E (2013) Neuro-Psychopharmaka - Ein Therapie-Handbuch: Band 4: Neuroleptika; S. 68 ↥ ↥ ↥
Lacey MG, Mercuri NB, North RA (1987): Dopamine acts on D2 receptors to increase potassium conductance in neurones of the rat substantia nigra zona compacta. J Physiol. 1987 Nov;392:397-416. doi: 10.1113/jphysiol.1987.sp016787. PMID: 2451725; PMCID: PMC1192311. ↥
Beckstead MJ, Grandy DK, Wickman K, Williams JT (2004): Vesicular dopamine release elicits an inhibitory postsynaptic current in midbrain dopamine neurons. Neuron. 2004 Jun 24;42(6):939-46. doi: 10.1016/j.neuron.2004.05.019. PMID: 15207238. ↥
Gantz SC, Bunzow JR, Williams JT. (2013): Spontaneous inhibitory synaptic currents mediated by a G protein-coupled receptor. Neuron. 2013 Jun 5;78(5):807-12. doi: 10.1016/j.neuron.2013.04.013. PMID: 23764286; PMCID: PMC3697754. ↥
Cooper, Bloom, Roth (2003): The biochemical Basis of Neuropharmacology, 8. Edition, S. 244 ↥ ↥
Skirboll LR, Grace AA, Bunney BS (1979): Dopamine auto- and postsynaptic receptors: electrophysiological evidence for differential sensitivity to dopamine agonists. Science. 1979 Oct 5;206(4414):80-2. doi: 10.1126/science.482929. PMID: 482929. ↥
Carlson JH, Bergstrom DA, Walters JR (1987): Stimulation of both D1 and D2 dopamine receptors appears necessary for full expression of postsynaptic effects of dopamine agonists: a neurophysiological study. Brain Res. 1987 Jan 6;400(2):205-18. doi: 10.1016/0006-8993(87)90619-6. PMID: 2880637. ↥
Piercey MF, Hyslop DK, Hoffmann WE (1996): Excitation of type II caudate neurons by systemic administration of dopamine agonists. Brain Res. 1996 Jan 15;706(2):249-58. doi: 10.1016/0006-8993(95)01151-x. PMID: 8822364. ↥ ↥
Seeman P, Madras BK (1998): Anti-hyperactivity medication: methylphenidate and amphetamine. Mol Psychiatry. 1998 Sep;3(5):386-96. doi: 10.1038/sj.mp.4000421. PMID: 9774771. REVIEW ↥
Ford CP, Phillips PE, Williams JT (2009): The time course of dopamine transmission in the ventral tegmental area. J Neurosci. 2009 Oct 21;29(42):13344-52. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3546-09.2009. PMID: 19846722; PMCID: PMC2791792. ↥
Rashid, So, Kong, Furtak, El-Ghundi, Cheng, O’Dowd, George (2007): D1-D2 dopamine receptor heterooligomers with unique pharmacology are coupled to rapid activation of Gq/11 in the striatum. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Jan 9;104(2):654-9. doi: 10.1073/pnas.0604049104. PMID: 17194762; PMCID: PMC1766439. ↥
Perreault ML, Hasbi A, O’Dowd BF, George SR (2014): Heteromeric dopamine receptor signaling complexes: emerging neurobiology and disease relevance. Neuropsychopharmacology. 2014 Jan;39(1):156-68. doi: 10.1038/npp.2013.148. PMID: 23774533; PMCID: PMC3857642. ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Kim H, Nam MH, Jeong S, Lee H, Oh SJ, Kim J, Choi N, Seong J (2022): Visualization of differential GPCR crosstalk in DRD1-DRD2 heterodimer upon different dopamine levels. Prog Neurobiol. 2022 Jun;213:102266. doi: 10.1016/j.pneurobio.2022.102266. Epub 2022 Mar 29. PMID: 35364139. ↥ ↥
Marcellino, Ferré, Casadó, Cortés, Le Foll, Mazzola, Drago, Saur, Stark, Soriano, Barnes, Goldberg, Lluis, Fuxe, Franco (2008): Identification of dopamine D1-D3 receptor heteromers. Indications for a role of synergistic D1-D3 receptor interactions in the striatum. J Biol Chem. 2008 Sep 19;283(38):26016-25. doi: 10.1074/jbc.M710349200. PMID: 18644790; PMCID: PMC2533781. REVIEW ↥
Durdagi S, Salmas RE, Stein M, Yurtsever M, Seeman P (2016): Binding Interactions of Dopamine and Apomorphine in D2High and D2Low States of Human Dopamine D2 Receptor Using Computational and Experimental Techniques. ACS Chem Neurosci. 2016 Feb 17;7(2):185-95. doi: 10.1021/acschemneuro.5b00271. PMID: 26645629. ↥ ↥
Homar-Ruano P, Cai NS, Casadó-Anguera V, Casadó V, Ferré S, Moreno E, Canela EI (2023): Significant Functional Differences Between Dopamine D4 Receptor Polymorphic Variants Upon Heteromerization with α1A Adrenoreceptors. Mol Neurobiol. 2023 Jul 18. doi: 10.1007/s12035-023-03476-8. PMID: 37464153. ↥
Ballesteros-Yáñez, Castillo, Merighi, Gessi (2016): The Role of Adenosine Receptors in Psychostimulant Addiction. Front Pharmacol. 2018 Jan 10;8:985. doi: 10.3389/fphar.2017.00985. PMID: 29375384; PMCID: PMC5767594. ↥
Ferré, Agnati, Ciruela, Lluis, Woods, Fuxe, Franco (2007): Neurotransmitter receptor heteromers and their integrative role in ‘local modules’: the striatal spine module. Brain Res Rev. 2007 Aug;55(1):55-67. doi: 10.1016/j.brainresrev.2007.01.007. PMID: 17408563; PMCID: PMC2039920. REVIEW ↥
Marcellino, Carriba, Filip, Borgkvist, Frankowska, Bellido, Tanganelli, Müller, Fisone, Lluis, Agnati, Franco, Fuxe (2008): Antagonistic cannabinoid CB1/dopamine D2 receptor interactions in striatal CB1/D2 heteromers. A combined neurochemical and behavioral analysis. Neuropharmacology. 2008 Apr;54(5):815-23. doi: 10.1016/j.neuropharm.2007.12.011. PMID: 18262573. ↥
Carriba, Navarro, Ciruela, Ferré, Casadó, Agnati, Cortés, Mallol, Fuxe, Canela, Lluís, Franco (2008): Detection of heteromerization of more than two proteins by sequential BRET-FRET. Nat Methods. 2008 Aug;5(8):727-33. doi: 10.1038/nmeth.1229. PMID: 18587404. ↥
Ferré, Goldberg, Lluis, Franco (2008): Looking for the role of cannabinoid receptor heteromers in striatal function. Neuropharmacology. 2009;56 Suppl 1(Suppl 1):226-34. doi: 10.1016/j.neuropharm.2008.06.076. PMID: 18691604; PMCID: PMC2635338. REVIEW ↥
Seeman P, Madras BK (1998): Anti-hyperactivity medication: methylphenidate and amphetamine. Mol Psychiatry. 1998 Sep;3(5):386-96. doi: 10.1038/sj.mp.4000421. PMID: 9774771. REVIEW ↥ ↥
Seeman P (2007): Antiparkinson therapeutic potencies correlate with their affinities at dopamine D2(High) receptors. Synapse. 2007 Dec;61(12):1013-8. doi: 10.1002/syn.20453. PMID: 17853435. ↥
George SR, Watanabe M, Di Paolo T, Falardeau P, Labrie F, Seeman P (1985): The functional state of the dopamine receptor in the anterior pituitary is in the high affinity form. Endocrinology. 1985 Aug;117(2):690-7. doi: 10.1210/endo-117-2-690. PMID: 4017954. ↥
George SR, Watanabe M, Di Paolo T, Falardeau P, Labrie F, Seeman P. (1985):The functional state of the dopamine receptor in the anterior pituitary is in the high affinity form. Endocrinology. 1985 Aug;117(2):690-7. doi: 10.1210/endo-117-2-690. PMID: 4017954. ↥
Paul B, Sribhashyam S, Majumdar S (2023): Opioid signaling and design of analgesics. Prog Mol Biol Transl Sci. 2023;195:153-176. doi: 10.1016/bs.pmbts.2022.06.017. Epub 2022 Aug 5. PMID: 36707153; PMCID: PMC10325139. REVIEW ↥
Yang (2021): Functional Selectivity of Dopamine D1 Receptor Signaling: Retrospect and Prospect. Int J Mol Sci. 2021 Nov 3;22(21):11914. doi: 10.3390/ijms222111914. PMID: 34769344; PMCID: PMC8584964. REVIEW ↥
Ahmed MR, Bychkov E, Gurevich VV, Benovic JL, Gurevich EV (2008): Altered expression and subcellular distribution of GRK subtypes in the dopamine-depleted rat basal ganglia is not normalized by l-DOPA treatment. J Neurochem. 2008 Mar;104(6):1622-36. doi: 10.1111/j.1471-4159.2007.05104.x. PMID: 17996024; PMCID: PMC2628845. ↥
McCarthy CS, Megaw P, Devadas M, Morgan IG (2007): Dopaminergic agents affect the ability of brief periods of normal vision to prevent form-deprivation myopia. Exp Eye Res. 2007 Jan;84(1):100-7. doi: 10.1016/j.exer.2006.09.018. PMID: 17094962. ↥
Prasad, de Vries, Elsinga, Dierckx, van Waarde (2021): Allosteric Interactions between Adenosine A2A and Dopamine D2 Receptors in Heteromeric Complexes: Biochemical and Pharmacological Characteristics, and Opportunities for PET Imaging. Int J Mol Sci. 2021 Feb 9;22(4):1719. doi: 10.3390/ijms22041719. PMID: 33572077; PMCID: PMC7915359. REVIEW ↥
Melis, Sanna, Argiolas (2022): Dopamine, Erectile Function and Male Sexual Behavior from the Past to the Present: A Review. Brain Sci. 2022 Jun 24;12(7):826. doi: 10.3390/brainsci12070826. PMID: 35884633; PMCID: PMC9312911. REVIEW ↥
Zhou X, Pardue MT, Iuvone PM, Qu J (2017): Dopamine signaling and myopia development: What are the key challenges. Prog Retin Eye Res. 2017 Nov;61:60-71. doi: 10.1016/j.preteyeres.2017.06.003. PMID: 28602573; PMCID: PMC5653403. ↥
Ramirez AD, Smith SM (2014): Regulation of dopamine signaling in the striatum by phosphodiesterase inhibitors: novel therapeutics to treat neurological and psychiatric disorders. Cent Nerv Syst Agents Med Chem. 2014;14(2):72-82. doi: 10.2174/1871524914666141226103421. PMID: 25540976. REVIEW ↥ ↥
Nishi A, Snyder GL (2010): Advanced research on dopamine signaling to develop drugs for the treatment of mental disorders: biochemical and behavioral profiles of phosphodiesterase inhibition in dopaminergic neurotransmission. J Pharmacol Sci. 2010;114(1):6-16. doi: 10.1254/jphs.10r01fm. PMID: 20716858. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥
Menniti FS, Faraci WS, Schmidt CJ (2006): Phosphodiesterases in the CNS: targets for drug development. Nat Rev Drug Discov. 2006 Aug;5(8):660-70. doi: 10.1038/nrd2058. PMID: 16883304. REVIEW ↥
Manganiello VC, Degerman E (1999): Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs): diverse regulators of cyclic nucleotide signals and inviting molecular targets for novel therapeutic agents. Thromb Haemost. 1999 Aug;82(2):407-11. PMID: 10605731. REVIEW ↥
Paterniti I, Esposito E, Cuzzocrea S (2014): Phosphodiesterase as a new therapeutic target for the treatment of spinal cord injury and neurodegenerative diseases. Curr Med Chem. 2014;21(24):2830-8. doi: 10.2174/0929867321666140217102428. PMID: 24533816. REVIEW ↥
Paronetto MP, Crescioli C (2024): Rethinking of phosphodiesterase 5 inhibition: the old, the new and the perspective in human health. Front Endocrinol (Lausanne). 2024 Sep 17;15:1461642. doi: 10.3389/fendo.2024.1461642. PMID: 39355618; PMCID: PMC11442314. REVIEW ↥
Delhaye S, Bardoni B (2021): Role of phosphodiesterases in the pathophysiology of neurodevelopmental disorders. Mol Psychiatry. 2021 Sep;26(9):4570-4582. doi: 10.1038/s41380-020-00997-9. PMID: 33414502; PMCID: PMC8589663. REVIEW ↥
Lakics V, Karran EH, Boess FG (2010): Quantitative comparison of phosphodiesterase mRNA distribution in human brain and peripheral tissues. Neuropharmacology. 2010 Nov;59(6):367-74. doi: 10.1016/j.neuropharm.2010.05.004. PMID: 20493887. ↥
Nishi A, Kuroiwa M, Miller DB, O’Callaghan JP, Bateup HS, Shuto T, Sotogaku N, Fukuda T, Heintz N, Greengard P, Snyder GL (2008): Distinct roles of PDE4 and PDE10A in the regulation of cAMP/PKA signaling in the striatum. J Neurosci. 2008 Oct 15;28(42):10460-71. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2518-08.2008. PMID: 18923023; PMCID: PMC2814340. ↥