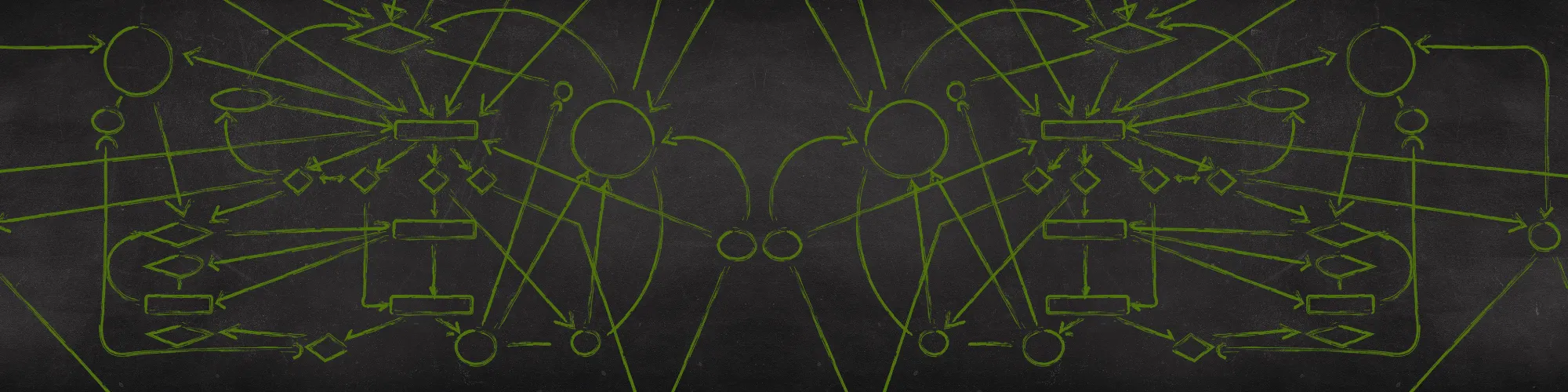Neurologische Grundlagen
An dieser Stelle erläutern wir einige Grundbegriffe der Neurologie, die für das weitere Verständnis hilfreich sind.
Zu den Grundlagen von Genen und Vererbung (Gene, Genexpression, DNA, RNA, Nukleotide, Proteine, Aminosäuren) siehe unter Bausteine von Vererbung und Verhalten: Gene, DNA, RNA, Proteine und Co
- 1. Neuronen
- 2. Gliazellen
- 3. Synapsen
- 4. Botenstoffe: Neurotransmitter, Hormone
- 5. Rezeptoren
- 6. Aktionspotential
- 7. Blut-Hirn-Schranke
- 8. Synaptische Plastizität: Lernen und Verlernen
- 9. Nervensystem - Aufbau und Regionen
- 10. Gehirnregionen und Funktionen - Hardware und Software
- 11. Kognition und Emotion, Gedanken und Emotionen
- 12. Konditionierung
- 13. Bildgebende Verfahren
- 13.1. Computertomographie (CT)
- 13.2. Magnetresonanztomographie (MRT / MRI)
- 13.3. Funktionelle MRT (fMRT)
- 13.4. Funktionelle Nah-Infrarot-Spektroskopie (fNIRS)
- 13.5. Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
- 13.6. Single-Photon-Emission-Computertomographie (SPECT)
- 13.7. SPECT-CT
- 13.8. Ultraschall (Sonographie)
- 13.9. Angiographie (digitale Subtraktionsangiographie, DSA)
- 13.10. Myelographie
- 14. Physiologische Messverfahren
- 15. Pharmakologische Messverfahren
- 16. Gentechnik
- 17. Aufnahmeformen von Medikamenten
- 18. Versuchsaufbauten für Tierversuche
- 19. Neuropsychologische Tests und was sie messen
1. Neuronen
Neuronen sind Nervenzellen. Sie bestehen aus
- Soma (dem eigentlichen Zellkörper, Perikaryon)
- Zytoplasma (bestehend aus dem Zytosol, der Zellflüssigkeit, und den darin schwimmenden Organellen (Mitochondrien, Golgi etc.))
- dem Nukleus (dem Zellkern im Soma)
- vielen Dendriten (an denen sie durch zigtausende bis Millionen Synapsen Informationen von anderen Zellen empfangen) und
- einem Axon (Neurit), über das sie Informationen an andere Zellen senden.
Während Dendriten maximal einige hundert Mikrometer kurz sind, können Axone beim Menschen zwischen 0,1 Millimeter und über einem Meter (oder sogar bis zu 4 Meter)1 lang sein. Das Axoplasma innerhalb des Axons umfasst mehr als 90 % des Zytosols. Der Axonhügel ist der Ursprung des elektrischen Signals der Nervenzelle und verbindet Zellkern und Axon. Am Ende eines Axons befinden sich Terminale, die die Information der präsynaptischen Zelle über chemische Synapsen an postsynaptische Zellen weitergeben. Die axonalen Synapsen docken meist an Dendriten, zuweilen an Soma und selten auch an Axone anderer Zellen an.
Axone können eine Myelinscheide aus Schwannzellen haben. Diese “isoliert” die elektrische Leitung des Axons und bewirkt mittels der Schnürringe, an denen die Isolierung unterbrochen ist, eine regelmäßige Verstärkung des weiterzuleitenden elektrischen Signals. Je dicker das Axon, und je besser es von Gliazellen (im Gehirn Oligodentrozyten, peripher Schwannzellen) ummantelt (myelinisiert) ist, desto schneller ist die elektrische Weiterleitung (bis zu 120 Meter/Sekunde).
Docken genug Neurotransmitter an die exzitatorischen Rezeptoren eines Neurons und wenig genug an inhibitorische Rezeptoren, wird ein Aktionspotenzial ausgelöst. Das Neuron feuert dieses als elektrischen Impuls über das Axon zu den aktiven Zonen an den Synapsen, wo dadurch Vesikel mit der Zellmembran verschmelzen und Neurotransmitter in den synaptischen Spalt freisetzen.
Nervenzellen können bis zu 500-mal/Sekunde feuern.
Das menschliche Gehirn hat ca. 100 Milliarden Nervenzellen.
Davon sind:2
glutamaterg - ca. 20.000.000.000 (20 Milliarden)
GABAerg - ca. 9.000.000.000 (8 Milliarden)
serotonerg - ca. 250.000
dopaminerg - ca. 250.0002, 400.000 bis 600.000
noradrenerg - ca. 30.000 bis 50.000
Entgegen früherer Annahmen sind Neuronen nicht strick auf einzelne Neurotransmitter beschränkt. Viele nehmen mehrere verschiedene Neurotransmitter auf und geben diese wieder ab.
Informationen werden durch eine gleichzeitige (rhythmische) Feuerung einer jeweiligen Gruppe von Nervenzellen repräsentiert.
Unipolare, bipolare und multipolare Neuronen
Bei unipolaren Neuronen ist das Axon ein Zweig des Dendriten. Unipolare Neuronen finden sich vor allem in Nervensystemen von Nichtwirbeltieren vor sowie im autonomen Nervensystem von Wirbeltieren.
Bipolare Neuronen haben ein ovales Soma, aus dem auf der einen Seite der Dendritenbaum und auf der anderen das Axon entspringen. Sinneszellen sind meist bipolare Neuronen.
Bei multipolaren Neuronen entspringen dem Soma eine Vielzahl von Dendriten sowie ein Axon. Die meisten Nervenzellen des Gehirns sind multipolar.
Sinnesneurone, Motorneurone, Interneurone
Sinnesneuronen empfangen Sinnessignale (Druck, Temperatur, Licht etc.) aus der Peripherie und senden diese an das Rückenmark.
Motorneuronen leiten Signale vom Gehirn und Rückenmark an Muskeln und Drüsen.
Interneuronen verbinden zwei andere Neurone untereinander (was die meisten Neuronen tun), integrieren Informationen anderer Neurone und haben keine Axone.
Lokale Interneurone verbinden nahegelegene Neurone und haben daher kurze Axone; Relay- oder Projektions-Interneuronen leiten das Signal in andere Gehirnregionen und haben daher lange Axone.
(https://media.sketchfab.com/models/b7d5d0a1996a4eddaa44a631ebff6e4f/thumbnails/b9ccaa7964d4445c868b0ef519cbfb71/a53650d6fb914ac0a02986a2f86da90b.jpeg)
Schematische Zeichnung einer Nervenzelle
[Nervenzelle als 3-D-Animation bei DocCheck Flexikon]
Bild eines Axons
Grundlegend: Shadlen, Kandel (2021): Nerve Cells, Neural Circuity and Behaviour. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science.
Ansammlungen von Neuronen heißen im ZNS Nucleus, im PNS Ganglion.
2. Gliazellen
Alle Zellen im Nervensystem, die keine Neuronen sind, heißen Gliazellen.
Im Nervensystem von Wirbeltieren finden sich 2- bis 10-mal so viele Gliazellen wie Neuronen. Nach neuerer Darstellung seien 1 zu 13 oder 2 Gliazellen auf 3 Neuronen.4
Gliazellen senden keine Signale, sondern unterstützen Nervenzellen.
2.1. Astrozyten (ZNS) / Mantelzellen (peripher)
Die sternförmigen Astrozyten sind die größten Gliazellen. Sie ernähren die Neuronen über Kontakte zu Blutgefäßen. Astrozyten sind maßgeblich an der Flüssigkeitsregulation im Gehirn beteiligt und sorgen für die Aufrechterhaltung des Kaliumhaushaltes.
Astrozyten (Astroglia) ist der Name dieser Zellen im zentralen Nervensystem. (Gehirn / Rückenmark)
Mantelzellen (Satellitenzellen) heißen diese Zellen, wenn sie im Körper (peripher) vorkommen.
Astrozyten und die von ihnen abgesonderten Faktoren (u.a. Thrombospondine 1 und 2, High Endothelial Venule Protein (HEVIN), sekretiertes saures und cysteinreiches Protein (SPARC), aus dem Gehirn stammende neurotrophe Faktoren (BDNF), transformierender Wachstumsfaktor β (TGF-β) und γ-Protocadherin) sind für die Ausbildung von Neuriten und (insbesondere glutamaterger, aber auch GABAerger, cholinerger und glycinerger) Synapsen bei RGC-Neuronen essenziell.5
ADHS korreliert mit Veränderungen der Astrozyten:5
- Glutamataufnahme durch Astrozyten über EAATs beeinträchtigt
- dies erhöht die Anzahl exzitatorischer Synapsen
- Die Aktivierung von GABAB-Rezeptoren in Astrozyten reguliert TSP-1 hoch
- dies erhöht die Bildung exzitatorischer Synapsen weiter
- verminderte Laktatproduktion in Astrozyten
- kann den Energiestoffwechsel der Neuronen beeinträchtigen
- Funktionsstörungen der Astrozyten
- beeinträchtigen die Integrität der Blut-Hirn-Schranke
- Zytokinfreisetzung In reaktiven Astrozyten erhöht
- Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) in Astrozyten erhöht
- dies erhöht oxidativen Stress und Neuroinflammation
2.2. Oligodendrozyten (ZNS) / Schwann-Zellen (peripher)
Bilden im ZNS die Myelinscheiden um Axone. In der Peripherie heißen diese Schwann-Zellen.
Oligodentrozyten bilden etliche Myelinsegmente mehrerer Neuronen, während Schwann-Zellen jeweils nur ein Myelinsegment zwischen zwei Ranvierringen bilden.
2.3. Ependymzellen
Bilden in den Ventrikeln des ZNS eine einzellige Schicht (das Ependym), welche die Hirnflüssigkeit (den Liquor) vom Hirngewebe trennt.
2.4. Mikroglia
Mikroglia sind Immuneffektorzellen im ZNS. Sie zählen lediglich formal zur Familie der Gliazellen. Genauer sind es Zellen des mononukleär-phagozytären Systems.
Sie werden bei Krankheiten oder Verletzungen aktiv. Dann vermehren sie sich und verschlingen tote oder absterbende Neuronen. Mikroglia können Entzündungen auslösen.
Grundlegend: Stevens, Polleux, Barres (2021): The Cells of the Nervous System. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science.
3. Synapsen
Synapsen sind die Verbindungsstellen, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren.
Es gibt
- elektrische Synapsen, die elektrische Signale direkt und damit sehr schnell weitergeben, was jedoch nur an kleinere Neuronen möglich ist und
- chemische Synapsen, bei denen das Signal über Neurotransmitter vermittelt wird, was erstens eine modulierende Steuerung ermöglicht und zweitens eine Verstärkung des Signals, sodass auch größere Neuronen adressiert werden können.
Während Muskelzellen meist nur von einem einzigen Motorneuron exzitatorisch gesteuert werden, und jedes einzelne Signal eine Muskelaktivierung bewirkt, sind Neuronen im Gehirn vielfach und redundant miteinander vernetzt, können anregend (exzitatorisch) oder hemmend (inhibitorisch) miteinander verbunden sein und benötigen für eine Aktivierung ein Zusammenwirken von vielen Signalen (oft 50 bis 100).
Grundlegend hierzu Yuste, Siegelbaum (2021): Synaptic Integration in the Central Nervous System. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science.
Symmetrische Synapse (Typ II Synapse)6
- eher inhibitorisch wirksam
- meist GABAerg
- abgeflachte Vesikel
- geringer ausgeprägte aktive Zone
- eher enger synaptischer Spalt
- prä- und postsynaptische Zone etwa gleich dick
- meist in Somanähe (axodendritisch, axosomatisch, axoaxonal)
Asymmetrische Synapse (Typ I Synapse)6
- eher exzitatorisch wirksam
- meist glutamaterg
- runde Vesikel
- breitflächige aktive Zone
- weiter synaptische Spalt
- postsynaptische Apparat (postsynaptic density)
- stark ausgeprägt, spricht man von einer asymmetrischen Synapse (auch Typ-I-Synapse)
- meist axo-spinal
4. Botenstoffe: Neurotransmitter, Hormone
Neurotransmitter sind Botenstoffe, die Informationen an chemischen Synapsen zwischen Nerven übertragen. Beispiele sind Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, Acetylcholin, GABA und Glutamat. Die unterschiedlichen Neurotransmitter haben verschiedene Aufgaben im Gehirn und überlappen sich in ihrer Wirkung.
Neurotransmitter bewirken durch ihre Ausschüttung an den Synapsen eine chemische Reizweiterleitung bzw. -blockade zwischen Neuronen (Nervenzellen).
Andere Botenstoffe, die Hormone, vermitteln ihre Wirkung langsam über die Blutbahn an weiter entfernte Zielorgane (z.B. Adrenalin, Cortisol, Estradiol, Insulin, Testosteron, Thyroxin, Triiodthyronin).
Manche Stoffe wirken zugleich als Neurotransmitter wie als Hormone (z.B. Noradrenalin, Serotonin, Histamin).Manche Stoffe wirken zugleich als Neurotransmitter als auch als Hormone (z.B. Noradrenalin, Serotonin, Histamin).
Neurotransmitter werden idR im Cytosol des Zellkerns synthetisiert, in Vesikel verpackt und über die Mikrotubuli durch die Axone zu den Nerventerminalen transportiert, wo sich die sendenden Synapsen befinden. Die Transportgeschwindigkeit in den Axonen ist je nach Substanz unterschiedlich und beträgt bis zu 5 µm/Sekunde = ca. 40 cm / Tag.7 Manche Neurotransmitter werden auch erst auf Anforderung an den Axon-Endigungen synthetisiert (z.B. Endocannabinoide).
Die Freisetzung von Neurotransmittern wird durch einen Anstieg des intrazellulären Ca2+ ausgelöst. Der intrazelluläre Ca2+ Anstieg wird durch eine Depolarisierung der präsynaptischen Nervenendigungen und einen Einstrom von Ca2+ über spannungsabhängige Ca2+-Kanäle (VDCCs) verursacht.8
Auf das Aktionspotenzial hin werden die Neurotransmitter aus den Nerventerminalen in den synaptischen Spalt ausgeschüttet, indem sich die Vesikel mit der Membran verbinden. Der synaptische Spalt ist zwischen 20 und 40 nm breit.9
Im synaptischen Spalt docken sie an postsynaptischen (selten auch “retrograd” an präsynaptischen, wie z.B. Endocannabinoiden und Stickstoffmonoxid) Rezeptoren an und öffnen dadurch Ionenkanäle, was in der empfangenden Zelle ein neues Aktionspotential auslösen kann.
Danach lösen sich die Neurotransmitter wieder von den postsynaptischen Rezeptoren und werden im oder am Rande des synaptischen Spalts durch präsynaptische Transporter in die sendende Zelle wiederaufgenommen. In der Zelle werden sie entweder erneut in Vesikel eingelagert bis zur nächsten Ausschüttung, oder durch abbauende Enzyme verstoffwechselt (z.B. Dopamin und Noradrenalin durch Monoaminoxidase und COMT).
Nicht wiederaufgenommene Neurotransmitter diffundieren in den extrazellulären Raum und können von dort aus Autorezeptoren der sendenden Zelle oder Rezeptoren oder Transporter anderer Zellen ansteuern.
Zweck der chemischen Signalübertragung durch Neurotransmitter ist die Filterung und Modulation von Signalen und die Möglichkeit einer Verstärkung des zu übertragenden Signals.
Nur die Neurone, die einen bestimmten Neurotransmitter freisetzen, enthalten alle Proteine, die für dessen Synthese erforderlich sind.10
Inverted-U: Zu hohe wie zu niedrige Neurotransmitterspiegel beeinträchtigen die Informationsübertragung bei Katecholaminen
Eine optimale Informationsübertragung erfordert - jedenfalls bei Katecholaminen (wie Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin) - einen optimalen Neurotransmitterspiegel. Ein verringerter wie ein erhöhter Spiegel beeinträchtigt die Signalübertragung. Eine optimale Informationsübertragung zwischen Gehirnsynapsen erfordert einen optimalen Pegel der beteiligten Neurotransmitter. Ein zu geringer Neurotransmitterspiegel führt zu nahezu identischen Folgen der Signalübertragungsstörung wie ein zu hoher Neurotransmitterspiegel (Inverted-U-Theorie).1112
- Die Aktivität des Locus coeruleus (Hauptquelle für kortikales Noradrenalin) zeigt eine Inverted-U-Relation zur Aufgabenleistung13
- Die DRD1-Aktivierung steht in einer Inverted-U-Relation zur Leistung des Arbeitsgedächtnisses1415
- Die Aktivität der DA-Neuronen im VTA steht in einer Inverted-U-Relation zur Leistung des Kurzzeitgedächtnisses16
Es gibt rund 500 verschiedene Neurotransmitter in verschiedenen Neurotransmitterklassen.
- Lösliche Gase
- Stickstoffmonoxid (NO)
- Kohlenstoffmonoxid (CO)
- Schwefelwasserstoff
- Amine
- Choline (quartäre Amine)
- Acetylcholin
- Biogene Amine
- (Klassische) Monoamine
- Katecholamine:
- Noradrenalin
- Adrenalin
- Dopamin
- Indolamine
- Serotonin
- Melatonin
- Imidazolamine
- Histamin
- Spurenamine
- Phenethylamine
- Phenethylamin (PEA)
- Tyramin
- Indolamine
- Tryptamin
- Phenethylamine
- Octopamin
- Katecholamine:
- (Klassische) Monoamine
- Choline (quartäre Amine)
- Aminosäuren
- Inhibitorische Aminosäuretransmitter
- Gamma-Amino-Buttersäure (GABA)
- Glycin
- β-Alanin
- Taurin
- Exzitatorische Aminosäuretransmitter
- Glutaminsäure (Glutamat)
- Asparaginsäure (Aspartat)
- Cystein
- Homocystein
- Inhibitorische Aminosäuretransmitter
- Neuropeptide
- Opioipeptide
- Dynorphine
- Dynorphin A
- Dynorhin B
- α-Neoendorphin
- β-Neoendorphin
- Endorphine
- Somatostatin
- Insulin
- Glucagon
- α-Endopsychosin
- Neurokinine / Tachykinine
- Substanz P (Neurokinin 1)
- Neurokinin A (Substanz K)
- Neuropeptid K (Neurokinin K)
- Neuropeptid γ (Neuropeptid gamma)
- Neurokinin B
- Hemokinin-1
- Endokinin A, B, C und D
- Enkephaline
- Met-Enkephalin
- Leu-Enkephalin
- Met-Arg-Phe-Enkephalin
- Dynorphine
- sonstige Neuropeptide
- Oxytocin
- Somatostatin
- Vasopressin
- Neuropeptid S
- GHRH
- Opioipeptide
- Endocannabinoide, z.B.
- Anandamid (AEA)
- 2-Arachidonylglycerol (2-AG)
- O-Arachidonylethanolamid
Neurotransmitter wirken je nach Rezeptor, an den sie andocken, exzitatorisch (aktivierend) oder inhibierend (hemmend) auf die nachfolgende Nervenzelle. Dopamin und Serotonin sind zwar überwiegend bei der Weitergabe inhibierender Informationen beteiligt, doch sind nur die D2, D3 und D4 Rezeptoren inhibierend (sie hemmen das Enzym Adenylylcyclase), während die D1 und D5 Rezeptoren aktivierend (exzitatorisch) wirken (sie aktivieren das Enzym Adenylylcyclase).
Bei ADHS ist die Informationsübertragung im Gehirn vornehmlich in Bezug auf die Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin beeinträchtigt.
Eine vertiefende und immer noch übersichtliche Darstellung der Neurotransmittersysteme findet sich bei Hinghofer-Szalkay unter physiologie.cc1718
5. Rezeptoren
Rezeptoren sind empfangende Andockstellen für Botenstoffe. Je nach Rezeptor kann ein Botenstoff hemmend oder aktivierend wirken.
Ionotrope Rezeptoren
Bei diesen bewirkt die Bindung eines Neurotransmitters unmittelbar die Öffnung eines Ionenkanals.
Metabotrope Rezeptoren
Bei diesen bewirkt die Bindung eines Neurotransmitters eine Aktivierung von Botenstoffen (Second Messenger), die wiederum etliche Transportkanäle adressieren können.
Alle Dopamin- und Noradrenalinrezeptoren sind metabotrop.
Grundlegend hierzu Siegelbaum, Clapham, Marker (2021): Modulation of Synaptic Transmission and Neuronal Excitability: Second Messengers. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science.
Exzitatorische und inhibitorische Rezeptoren.
Rezeptoren für ein und denselben Neurotransmitter können exzitatorisch (die postsynaptische Nervenspannung erhöhend) und inhibitorisch (die postsynaptische Nervenspannung verringernd) wirken.
Dagegen sagen weder das Feuern von Neuronen noch die Art des Neurotransmitters etwas darüber aus, ob ein Signal aktivierend (exzitatorisch) oder hemmend (inhibitorisch) sein soll.
5.1. Agonisten und Antagonisten
Liganden sind Stoffe, die an Rezeptoren binden.
Biased ligands sind Liganden, die bei Rezeptoren die Signalisierung nur über bestimmte Signalpfade auslösen. G-Protein gekoppelte Rezeptoren vermitteln ihr Signal über verschiedene G-Proteine (GTPasen; 20 trimere und mehr als hundert “kleine” G-Proteine). Biased ligands lösen nur einzelne G-Protein-Signalpfade aus.
Agonist: Bindung an Rezeptor aktiviert diesen und löst das Rezeptorsignal aus.
Konventioneller Agonist: erhöht den Anteil der aktivierten Rezeptoren.
Partieller Agonist / Partialagonist: gering wirksamer Agonist.
Manche Agonisten wirken in einem Gewebe partial und in einem anderen Gewebe als vollständiger Agonist.
Inverser Agonist: Bindet an spontanaktiven Rezeptor und verringert dessen Aktivität. Beispiel: Antihistaminika.
Spontanaktiv sind Rezeptoren, die auch ohne Reiz Signale senden.
Antagonist: bindet an Rezeptor ohne eigene Wirkung. Verhindert dadurch Rezeptoraktivierung durch andere Stoffe.
Antagonisten, die Wirkungen einer Substanz blockieren, die normalerweise die zelluläre Funktion vermindert, erhöhen die zelluläre Funktion.
Antagonisten, die Wirkungen einer Substanz blockieren, die normalerweise die zelluläre Funktion erhöhen, vermindern die zelluläre Funktion.
Reversibler Antagonist: Löst sich nach der Bindung an den Rezeptor leicht wieder von diesem.
Irreversibler Antagonist: Löst sich nicht mehr von Rezeptor, weil er eine stabile, dauerhafte oder nahezu dauerhafte chemische Verbindung bildet (z.B. bei Alkylierung).
Pseudoirreversibler Antagonist: dissoziiert langsam von ihrem Rezeptor.
Kompetitiver Antagonist: verhindert die Bindung eines Agonisten an den Rezeptor.
Nicht-kompetitiver Antagonist: kann gleichzeitig Agonist und Antagonist binden. Die Bindung des Antagonisten vermindert oder verhindert die Wirkung des Agonisten.
Reversibler kompetitiver Antagonist: Agonist und Antagonist gehen kurzzeitige Bindungen mit dem Rezeptor ein. Es entsteht ein Gleichgewicht zwischen Agonist und Antagonist am Rezeptor.
Eine Konzentrationserhöhung des Agonisten kann einen reversiblen kompetitiven Antagonismus überwinden.
Beispiel: Der Opioidrezeptorantagonist Naloxon, kurz vor dem Agonisten Morphin gegeben, blockiert die Wirkung des Agonisten Morphin. Eine Erhöhung des Agonisten Morphin kann den kompetitiven Antagonismus durch Naloxon überwinden.
Irreversibler Antagonismus ist ein Unterfall des nicht-kompetitiven Antagonismus.
Neutraler Antagonist: hat die gleiche Affinität zum aktiven und inaktiven Rezeptorzustand und greift nicht in die Basalaktivität der Zelle ein.
Agonist-Antagonist: wirkt als Agonist und als Antagonist zugleich
Strukturelle Analoga von Agonisten zeigen diese Eigenschaft häufig.
Beispiel: Pentazocin aktiviert Opioidrezeptoren und blockiert zugleich deren Aktivierung durch andere Opioide. Dadurch wirkt Pentazocin selbst opioiderg, schwächt aber die Wirkung anderer Opioide ab, solange es noch gebunden ist.
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren können je nach an sie bindendem Ligand verschiedene Konformationszustände aufweisen.19
5.2. Konstitutive Aktivität
Nicht immer benötigt ein Rezeptor einen Agonisten, um in einen aktiven Konformationszustand zu gelangen, durch den erhöhte Grundwerte der intrazellulären Signalübertragung erhalten bleiben.
Zahlreiche GPC-Rezeptoren (z.B. der CB1R) zeigen ein hohes Maß an konstitutiver Aktivität.
Das Zwei-Zustands-Modell der Rezeptoraktivierung erklärt dies:
Rezeptoren befinden sich im Gleichgewicht zwischen dem aktiven und dem inaktiven Zustand. Ein Agonist stabilisiert den aktiven Zustand, der zur Aktivierung führt, ein neutraler Antagonist bindet gleichermaßen an aktive und inaktive Zustände, während ein inverser Agonist bevorzugt den inaktiven Zustand stabilisiert.
5.3. Allosterische Modulatoren
Rezeptoren können verschiedene Bindungsstellen haben. An der orthosterischen Bindungsstelle binden Agonisten (aktivieren Rezeptor) und Antagonisten (hemmen Rezeptor). An der allosterischen Bindungsstelle können Modulatoren andocken, die die Wirkung des Rezeptors, falls ein Agonist an ihn bindet, erhöhen oder verringern können.
Ein allosterischer Modulator verändert somit die Effekte eines orthosterischen Liganden (z.B. eines Agonisten oder inversen Agonisten) an einem Zielprotein (in der Regel einem Rezeptor) indem er an eine andere (allosterische) Bindungsstelle als die orthosterische Agonistenbindungsstelle binden. Dadurch bewirkt er eine Konformationsänderung des Rezeptor-Proteins, was die Rezeptor-Affinität oder die Efficacy des orthosterischen Liganden ändert.
Positiver allosterischer Modulator (PAM): verstärkt die Wirkung eines Agonisten oder inversen Agonisten.
Negativer allosterischer Modulator (NAM): schwächt die Wirkung eines Agonisten oder inversen Agonisten ab, ohne selbst eine Wirkung zu zeigen.
Stiller Modulator (SAM): Besetzt die allosterische Bindungsstelle, ohne die Wirkung von Agonisten oder inversen Agonisten zu beeinflussen.
Allosterischer Agonist: Aktiviert Rezeptor in Abwesenheit eines orthosterischen Liganden über eine Bindung an einer allosterischen Bindungsstelle
Ago-allosterischer Modulator: wirkt als allosterischer Agonist (Aktivator) wie auch als allosterischer Modulator. Beispiel: Injektionsnarkotika-Barbiturate
On-target Allosterisierung: Modulator bindet am selben Protein wie der orthosterische Ligand
Off-target Allosterisierung: Modulator bindet an ein Partner-Protein. Beispiel: GPCR-Oligomere.
5.4. Downregulation, Upregulation, Desensitisierung
Unter anderem die Rezeptoren für Dopamin, Noradrenalin, Cannabinoide, Adenosin, Serotonin und Opioid sind Mitglieder der GPCR-Familie. GPCR unterliegen häufig einer dynamischen Veränderung ihrer Aktivität.
Ein Mangel an Agonisten kann zu einer Upregulation führen
Ein lang anhaltender Überschuss an Agonisten kann eine Desensitivierung und Downregulation bewirken.20
Agonisten können eine zeit- und temperaturabhängige Endozytose (Internalisierung) auslösen. Während der Endozytose werden einige Rezeptorproteine wieder in die Zellmembran integriert (Recycling), während andere aussortiert und durch Lysosomen abgebaut werden, was die Rezeptoranzahl verringert.2122
Homologe Desensitisierung
Der Rezeptor, der einen Liganden gebunden hat, wird durch eine Kinase (G-Protein-gekoppelte Rezeptorkinase, GRK) phosphoryliert. Diese Phosphorylierung stabilisiert die Bindung zwischen dem Rezeptor und Arrestinen. Dies verhindert die Interaktion mit dem G-Protein und unterbricht die Signalweiterleitung.
Heterologe Desensitisierung
Die Signalkette eines Rezeptors wird (unabhängig von der Ligandenbindung) aufgrund einer Aktivierung anderer Rezeptoren auf der Zelloberfläche unterbrochen bzw. verringert. Die aktivierten Rezeptoren aktivieren über Second-Messenger-Kinasen (z.B. Proteinkinase A, Proteinkinase C), die nicht den aktivierten Rezeptor selbst, sondern andere Rezeptoren phosphorylieren.
6. Aktionspotential
Neuronen vermitteln Signale, indem sie ein Aktionspotential auslösen.
Neuronen enthalten im Ruhezustand in ihrem Inneren eine um durchschnittlich 65 mV (je nach Zellart zwischen 45 und 90 mV) niedrigere Spannung als der extrazelluläre Raum. Dieser Spannungsunterschied entsteht, indem die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe (Natrium-Kalium-ATPase, ein Membranprotein), Natriumionen aus dem Zellinneren gegen Kaliumionen aus dem Extrazellulärraum tauscht. Durch kaliumdurchlässige Ionenkanäle in der selbst undurchlässigen Zellmembran können die Kaliumionen - dem Konzentrationsgefälle folgend - langsam wieder die Zelle verlassen und hinterlassen dabei eine nicht neutralisierte negative Ladung an der inneren Zellmembranoberfläche, die in der Regel bei -65 mV liegt.
In den Zellen befinden sich dann im Ruhezustand rund 1/10 an Natriumionen und das 20-fache an Kaliumionen wie extrazellulär. Das extrazelluläre Natrium- und Kaliumionenniveau wird durch die Nieren und die Astrozyten aufrechterhalten. Gelangen Natrium- oder Calciumionen in die Zelle, steigt deren Spannung.
Ein Aktionspotential (ein schneller Spannungsanstieg um +10 mV, z.B. von -65 auf -55 mV) macht die Zellmembran durchlässiger für Natriumionen als für Kaliumionen. Der dadurch gesteigerte Eintritt von Natriumionen erhöht die Zellwanddurchlässigkeit für Natriumionen weiter, sodass immer mehr Natriumionen eintreten. Dadurch verringert sich die negative Spannung schlagartig und verkehrt sich sogar kurzfristig (für rund 1 ms) ins Positive auf + 40 mV (“Overshoot”). Das Aktionspotential wandert nun mit 1 bis 100 Metern/Sekunde das Axon entlang bis zu den Terminalen, wo es Ionenkanäle öffnet.
Das Aktionspotential ist eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Wird es ausgelöst, hat es stets die volle Stärke, egal ob die Auslösungsschwelle nur ganz knapp oder stark überschritten ist.
Das Aktionspotential bleibt über die gesamte Strecke im Axon konstant. Dazu wird es an den Ranvier-Schnürringen verstärkt.
Nachdem das Spannungsmaximum erreicht ist, erfolgt durch das Schließen von Natrium- und das Öffnen von Kaliumkanälen die Rückkehr zum Ruhepotential (Repolarisation).
Dabei wird die Membranspannung zunächst noch negativer, als das ursprüngliche Ruhepotential war (Hyperpolarisation). Danach kehrt die Zelle zum Ausgangspunkt zurück (Ruhepotential).
Nach der Auslösung eines Aktionspotentials unterliegt ein Neuron einer Pause, der Refraktionsperiode.
Phasen des Aktionspotentials:23
- Initiationsphase
- Spannung steigt (langsam oder schnell) in Richtung Schwellenpotenzial, z.B. von -70 mV auf -50 mV (initiale Depolarisation)
- Erreichen eingehende Reize (nach Summierung im Axonhügel) den Schwellwert nicht, bleibt es bei einer vorübergehenden, reversible Veränderung des Membranpotentials
- Aufstrich
- Nur und erst bei Erreichen des Schwellenpotenzials erfolgt eine vollständige Depolarisation
- Folge:
- Die spannungsabhängigen Natriumkanäle öffnen sich und lassen aus dem Extrazellulärraum schlagartig Na+-Ionen in das Zytosol des Neurons einströmen
- Die Kaliumkanäle sind währenddessen geschlossen
- Ein positiver Rückkopplungsmechanismus bewirkt am Ende gar eine Ladungsumkehr (“Overshoot”).
- Repolarisation
- Natriumkanäle beginnen noch vor dem Potentialmaximum, sich wieder zu schließen
- Die spannungsabhängigen Kaliumkanäle öffnen sich, sodass K+-Ionen aus dem Zellinneren in den Extrazellulärraum strömen
- Die Leitfähigkeit der Kaliumkanäle erreicht ihr Maximum, wenn fast alle Natriumkanäle bereits inaktiviert sind
- Während der Repolarisation bewegt sich das Potential wieder in Richtung des Ruhepotentials, was zur Schließung der Kaliumkanäle führt, während die Natriumkanäle langsam wieder aktiviert werden.
- Hyperpolarisation
- Kaliumkanäle schließen sich binnen 1 bis 2 ms, und damit langsamer als Natriumkanäle
- Währenddessen sinkt das Membranpotential unter das eigentliche Ruhepotential (“Hyperpolarisation”)
- Refraktärzeit
- nach einem Aktionspotential ist das Neuron für eine kurze Zeit nicht erregbar
- so lange, bis die Natriumkanäle wieder aktivierbar sind
- Absolute Refraktärphase: Zeitspanne kurz nach dem Overshoot, vor Abschluss der Repolarisation. Aktionspotential nicht auslösbar.
- Relativen Refraktärphase: Schwellenwert für die Auslösung eines Aktionspotentials ist erhöht
Während das Aktionspotential immer gleich stark und der einzige ausgehende Impuls eines Neurons ist, gibt es zwei Arten von aktivierenden Impulsen:
- das synaptische Signal
- das Rezeptorsignal.
Beide sind von der Stärke her abgestuft (graduell).
Rezeptorsignale werden beispielsweise durch periphere sensorische Reize ausgelöst. Ein Rezeptorsignal entspricht in Dauer und Stärke der Intensität des Reizes, ist aber insgesamt relativ schwach. Es reicht innerhalb des Neurons nur wenige Millimeter weit. Nach einem Millimeter hat es bereits zwei Drittel seiner Energie verloren. Erreicht es innerhalb seiner Reichweite mit ausreichender Stärke einen Ranvier-Schnürring, wird durch dessen Verstärkungseffekt ein vollständiges Aktionspotential ausgelöst, sodass der sensorische Reiz das Rückenmark erreichen kann.
Synaptische Signale werden durch Neurotransmitterbindung an empfangenden Synapsen an Dendriten ausgelöst. Sie sind, wie das Rezeptorsignal, graduell je nach Menge der aktivierten Rezeptoren. Synaptische Signale werden am Axonhügel des Neurons aufsummiert. Wenn die Summe den Schwellenwert überschreitet, wird das Aktionspotential ausgelöst.
Auch wenn ein Aktionspotential immer gleich stark ist, kann es durch die Häufigkeit und Frequenz seiner Abfolge eine graduell abgestufte Neurotransmitterausschüttung bewirken und so wieder unterschiedlich starke Signale an die postsynaptisch verbundenen Zellen weitergeben. Wird ein Aktionspotential nur einmal ausgelöst. Je häufiger und schneller hintereinander das Aktionspotential ausgelöst wird, desto größer ist die Menge der Transmitterausschüttung, was zu einer höheren Anzahl an postsynaptisch adressierten Rezeptoren führt.
Grundlegend hierzu Koester, Siegelbaum (2021): Membrane Potential and the Passive Electrical Properties of the Neuron. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science sowie Bean, Koester (2021): Propagated Signaling: The Action Potential. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science.
7. Blut-Hirn-Schranke
Das menschliche Gehirn wird von rund 600 km Blutgefäßen durchzogen.
Blutgefäße im Gehirn verfügen in ihren Wänden über besondere Zellen, die verhindern, dass bestimmte Stoffe, die im Körper (peripher) unschädlich sind, die komplexen und empfindlichen Abläufe des Gehirns (zentral) stören, und dass Neurotransmitter und Kalium aus der extrazellulären Gehirnflüssigkeit ins Blut austreten.
Nur fettlösliche Substanzen mit einem Molekulargewicht unter 500 Da können durch die Blut-Hirn-Schranke diffundieren, wie z.B. Nikotin, Alkohol, Blutgase oder Narkotika wie Halothan, nicht aber Ionen oder polare Substanzen wie Glucose. Letztere sind auf spezifische Transportsysteme angewiesen, die so eine Regelungs- und Filterfunktion ausüben.24
8. Synaptische Plastizität: Lernen und Verlernen
Synaptische Plastizität bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, neue Verbindungen zwischen Nervenzellen zu erstellen, was im Ergebnis Wissen und Erfahrung repräsentiert, und diese wieder zu entfernen. Synaptische Plastizität beinhaltet auch die Erhöhung oder Verringerung der Aktivität und Stabilität der Feuerung.
Verschiedene Arten der synaptischen Plastizität sind:
- Kurzzeitplastizität: Veränderung der synaptischen Aktivität über Millisekunden bis Sekunden
- Langzeitplastizität: Veränderung der synaptischen Aktivität über Stunden, Tage oder länger
- Strukturelle Plastizität: Veränderung der Anzahl und Organisation der Synapsen
- Funktionelle Plastizität: Veränderung der Freisetzung und Modulation von Transmittersubstanzen
- Präsynaptische Plastizität: Anpassungsmechanismen zur Modulation der synaptischen Übertragung an der Präsynapse
8.1. Kurzzeitplastizität
8.1.1. Depolarisation induziert Unterdrückung der Hemmung (DSI) oder Erregung (DSE)
Eine durch starke Aktivierung (wiederholtes Aktionspotenzial oder eine Stufendepolarisation) verursachte Depolarisation induziert in vielen Neuronen eine vorübergehende Unterdrückung der Hemmung (DSI) oder der Erregung (DSE).25
Diese Hemmungsunterdrückung hält einige Dutzend Sekunden lang an.
Inhibitorische Synapsen reagieren empfindlicher auf eine Depolarisation-induzierte Unterdrückung der synaptischen Übertragung als exzitatorische Synapsen.
DSE ist auf einen funktionsfähigen Endocannabinoid-Transporter angewiesen.26
8.1.2. Metabotrop induzierte Unterdrückung der Hemmung (MSI) oder Erregung (MSE)
Metabotrop (mittels eines Stoffwechselprozesses) induzierte Unterdrückung der Hemmung (MSI) oder der Erregung (MSE) sind Formen der synaptischen Kurzzeitplastizität.25
MSI und MSE werden durch eine Vielzahl von Gq/11-gekoppelten GPCRs ausgelöst, darunter mGluR1, mGluR5, M1, M3, OrexinA, CCKA und α1-adrenergen Rezeptoren.
8.2. Langzeitplastizität
8.2.1. Langzeitpotenzierung (LTP, Long term potentiation)
Langzeitpotenzierung (LTP) ist eine universelle Form einer lang anhaltenden Stärkung von synaptischen Verbindungen.
LTP kann entstehen durch
- erhöhte Bildung von Aktionspotenzialen
- verbesserte Kommunikation zwischen zwei Zellen
- Vergrößerungen der Synapsen
- Entstehung neuer Kanäle
- Erhöhte Ausschüttung von Neurotransmittern
8.2.2. Langzeitdepression (LTD, Long term depression)
Langzeitdepression (LTD) ist eine universelle Form einer lang anhaltenden Verringerung der synaptischen Verbindungen, die zig Minuten bis mehrere Stunden oder länger anhält.27
Homosynaptische LTD: Betrifft nur diejenige Synapse, die von der anhaltenden niederfrequenten Aktivität des präsynaptischen Neurons erreicht wird. Betrifft insbesondere glutamatergen Synapsen im dorsalen und ventralen Striatum.25
Heterosynaptische LTD: betrifft auch inaktive Neurone. Die Signalabschwächung wird von einem angrenzenden modulierenden Interneuron gesteuert und ist nicht von der Aktivität des präsynaptischen oder postsynaptischen Neurons abhängig. Z.B. bewirkt die Stimulation der Schaffer-Kollateralen im CA1 des Hippocampus eine anhaltende Abnahme der GABAergen Hemmung der CA1-Pyramidenneuronen.25
Autaptische LTD: autaptische Neuronen zeigen sowohl eine Endocannabinoid-vermittelte DSE und MSE. Eine autaptische LTD ist auf CB1R angewiesen, wobei die autaptische LTD nicht über die typischerweise von CB1R aktivierten G(i/o)- oder G(s)-Proteine, sondern über G(q)-Proteine induziert wird.27
8.2.3. Langsame Selbsthemmung (SSI, slow self inhibition)
Langsame Selbsthemmung (SSI) ist ein Prozess, der die neuronale Erregbarkeit unterdrückt. SSI tritt vor allem in niederschwellig spikenden, kortikalen Interneuronen und Kleinhirnkorbzellen, aber auch in einigen kortikalen Hauptzellen auf.25
9. Nervensystem - Aufbau und Regionen
Das Nervensystem besteht aus dem zentralen Nervensystem (ZNS, Gehirn und Rückenmark) und dem peripheren Nervensystem (PNS, Körper).
Im Laufe der Evolution haben sich nach und nach verschiedene Gehirnbereiche entwickelt, die wir nachfolgend von alt nach neu darstellen.
Grundlegend zu den Gehirnbereichen des Menschen: Kandel, Shadlen (2021): The Brain and Behaviour. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science.
9.1. Peripheres Nervensystem
Die Nerven des PNS entspringen dem Rückenmark und den 12 paarigen Hirnnerven.
Die 12 Hirnnerven sind:
- Nervus olfactorius (Riechnerv; leitet Signale der Nase zum Gehirn)
- Nervus opticus (Sehnerv; leitet Signale der Netzhaut zum Gehirn)
- Nervus oculomotorius (steuert Augenbewegungen, Lidheber und Iris (Regenbogenhaut))
- Nervus trochlearis (steuert den schrägen oberen Augenmuskel)
- Nervus trigeminus (leitet sensorische Informationen aus dem Gesichtsbereich zum Gehirn, innerviert die Kaumuskeln)
5.1. Nervus ophthalmicus
5.2. Nervus maxillaris
5.3. Nervus mandibularis - Nervus abducens (innerviert den lateralen Augenmuskel)
- Nervus facialis (Gesichtsnerv; steuert Mimikmuskulatur und Musculus stapedius, vermittelt Geschmackswahrnehmung der vorderen zwei Dritteln der Zunge, innerviert alle Kopfdrüsen außer Ohrspeicheldrüse)
- Nervus vestibulocochlearis (Hörnerv; leitet Informationen von Hörschnecke und Gleichgewichtsorgan)
- Nervus glossopharyngeus (Leitet die Signale des hinteren Zungenabschnittes zum Gehirn, innerviert die Rachenmuskeln des Rachens (Schlucken), innerviert die Ohrspeicheldrüse)
- Nervus vagus (Hauptnerv des Parasympathikus; an der Regulation vieler innerer Organe beteiligt)
- Nervus accessorius (steuert motorisch den Musculus trapezius und den Musculus sternocleidomastoideus)
- Nervus hypoglossus (steuert die Zungenbewegung)
9.1.1. Somatisches Nervensystem
Das somatische Nervensystem (SNS) interagiert mit der äußeren Umwelt.
Afferente Nerven leiten sensorische Signale z.B. von Haut, Skelettmuskeln, Gelenken, Augen und Ohren zum ZNS (lösen Affekte aus)
Efferente Nerven leiten die motorischen Signale vom ZNS zu den Skelettmuskeln (lösen motorische Effekte aus).
9.1.2. Autonomes Nervensystem
Das autonome Nervensystem (ANS) reguliert das innere Milieu des Körpers.
Afferente Nerven leiten sensorische Signale von inneren Organen zum ZNS (lösen Affekte aus).
Efferente Nerven (sympathisches und parasympathisches Nervensystem) leiten motorische Signale vom ZNS an die inneren Organe (lösen motorische Effekte aus).
Jedes autonome Erfolgsorgan erhält aktivierenden sympathischen und beruhigenden parasympathischen Input. Das Verhältnis von sympathischem zu parasympathischem Input kontrolliert die Aktivität des Organs.
Siehe hierzu genauer unter Das vegetative Nervensystem: Sympathikus / Parasympathikus
9.1.2.1. Sympathisches Nervensystem
Die sympathischen Nerven ziehen von Brust- und Lendenwirbelsäule in den Körper.
Umschaltung (via Synapsen auf andere Neuronen) weiter von den Erfolgsorganen entfernt.
Aktivieren Energiereserven in bedrohlichen Situationen (Anspannung).
9.1.2.2. Parasympathisches Nervensystem
Die parasympathischen Nerven ziehen vom Gehirn und sakralen (Kreuz-
wirbel) Bereichen der Wirbelsäule.
Umschaltung (via Synapsen auf andere Neuronen) in der Nähe der Erfolgsorgane.
Konservieren Energie in ruhigen Situationen (Entspannung).
9.2. Zentrales Nervensystem
9.2.1. Rückenmark
Das Rückenmark (Medulla spinalís) empfängt und verarbeitet sensorische, periphere Reize.
9.2.2. Gehirn
Das Gehirn wird auch Encephalon genannt.
Es besteht aus verschiedenen funktionell getrennten Teilen, die miteinander verbunden sind.
9.2.2.1. Hirnstamm
Das embryonale Hinterhirn (Metencephalon) entwickelt sich zu Brücke (Pons) und Kleinhirn (Cerebellum).
Hinterhirn und Hirnstamm bilden zusammen das Rautenhirn (Rhombencephalon).
Das Stammhirn (Truncus encephali) ist der evolutionär älteste Gehirnteil.
- verschaltet und verarbeitet eingehende Sinneseindrücke und ausgehende motorische Informationen
- zuständig für elementare und reflexartige Steuermechanismen
- unterster Gehirnbereich, direkt am Rückenmark
- bestehend aus
- Mittelhirn (Mesencephalon)
- Brücke (Pons)
- Medulla oblongata (verlängertes Mark; Nachhirn; Myelencephalon)
- incl. Formatio reticularis (aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem)
- besteht aus rund 100 Kernen
- Aufmerksamkeit
- Schlaf
- Bewegung
- Muskeltonus
- Reflexe
- Herz
- Kreislauf
- Atmung
- besteht aus rund 100 Kernen
- hier kreuzen sich die Hemisphären-Nervenbahnen
- steuert viele automatisch ablaufende Vorgänge wie
- Herzschlag
- Atmung
- Stoffwechsel
- Reflexzentren, z.B. für
- Lidschluss
- Schlucken
- Husten
- incl. Formatio reticularis (aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem)
Der Hirnstamm als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
Das Mesencephalon als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
Die Medulla oblongata als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
9.2.2.2. Kleinhirn (Cerebellum)
Unterscheidet zwei Hemisphären
Verantwortlich für
- Gleichgewicht
- Bewegungen
- Bewegungskoordination
- unbewusstes Lernen
- Spracherwerb
- soziales Lernen
Das Kleinhirn als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
9.2.2.4. Zwischenhirn (Diencephalon)
Das Zwischenhirn ist beteiligt an
- Schlaf-Wach-Steuerung (siehe ARAS, Schmerzempfindung, Temperaturregulation).
Das Zwischenhirn besteht aus:
Thalamus (oberer Teil)
- vermittelt sensorische und motorische Signale zum und vom Großhirn
- sammelt alle Informationen der Sinnesorgane und vermittelt diese weiter
- besteht hauptsächlich aus grauer Substanz
Hypothalamus
- steuert zahlreiche körperliche und psychische Lebensvorgänge
- wird teils neuronal über das vegetative Nervensystem, teils hormonell über den Blutweg gesteuert
- verbunden mit Hypophyse (Hirnanhangdrüse)
Hypothalamus und Hypophyse sind das zentrale Bindeglied zwischen dem Hormon- und dem Nervensystem.
Subthalamus (Thalamus centralis)
- bestehend aus
- Nucleus subthalamicus
- Pallidum (nicht zu verwechseln mit Globus pallidus)
- Steuerung der Grobmotorik
Epithalamus
- bestehend aus
- Zirbeldrüse (Epiphyse, Corpus pineale, Glandula pinealis)
- Subcommissuralorgan (Organum subcommissurale)
- Commissura habenularum
- Commissura posterior (Commissura epithalamica)
- Habenulae (Zügel)
- Area pretectalis
Das Zwischenhirn als 3-D-Animation bei dasGehirn.info.
9.2.2.5. Großhirn (Cortex cerebri, Cerebrum, Endhirn, Telencephalon)
Teile des Großhirns sind:
Großhirnrinde (Cortex cerebri)28
- Oberflächenschicht des Großhirns
- 2–4 mm dick
- stark gefaltet (wie ein Tuch in einem Glas)
- knapp einen Viertel Quadratmeter groß
- enthält rund 1629 oder 19 (bei Frauen) bis 23 Milliarden bei Männern30(ca. 20 % des gesamten Gehirns)
- Zellschichten je nach entwicklungsgeschichtlichem Alter31
- Allocortex (älter; z.B. Hippocampus): 3 Schichten. Von außen nach innen:
- Archicortex
- Molekularschicht (Lamina molecularis)
- Pyramidenzellschicht (Lamina pyramidalis)
- polymorphe Schicht (Lamina multiformis)
- Paleocortex
- drei bis fünf Zellschichten
- verarbeitet vor allem Geruch und Geschmack
- Archicortex
- Mesocortex
- Zwischenform aus Allocortex und Isocortex
- drei bis sechs Schichten
- befindet sich in Insula, Cingulum und Gyrus parahippocampalis
- Isocortex (jünger, Neokortex; 90 % des menschlichen Cortex): 6 Schichten. Von außen nach innen:
- Molekularschicht (Lamina molecularis)
- Äußere Körnerzellschicht (Lamina granularis externa)
- Äußere Pyramidenzellschicht (Lamina pyramidalis externa)
- Innere Körnerzellschicht (Lamina granularis interna)
- Innere Pyramidenzellschicht (Lamina pyramidalis interna)
- polymorphe Schicht (Lamina multiformis)
- Allocortex (älter; z.B. Hippocampus): 3 Schichten. Von außen nach innen:
- ist in zwei Hemisphären (Halbkugeln) geteilt
- jede Hemisphäre ist in 4 Großhirnrindenlappen geteilt
- frontal (PFC)
- höhere kognitive Prozesse
- Kontrolle der Willkürmotorik, Aufmerksamkeit, Kurzzeitgedächtnisaufgaben, Motivation und Planung
- parietal (Parietallappen, Scheitellappen, oben)
- somatosensorische Funktionen
- visuelle Steuerung von Bewegungen und Erkennung von Reizen im Raum
- räumliches Denken und „quasi-räumliche“ Prozesse wie Rechnen und Lesen
- Sprachverarbeitung
- Schnittstelle zwischen den Sinnessystemen (vor allem des visuellen Systems) und dem motorischen System für die Berechnung, Ausführung und Kontrolle von Hand und Augenbewegungen.
- okzipital (hinten)
- visueller Cortex (visuelle Verarbeitung)
- temporal (Seitenlappen)
- auditorischer Cortex (akustische Verarbeitung)
- Deutung der Informationen, entsprechend dem visuellen Gedächtnis und dem Sprachverständnis
- frontal (PFC)
- jede Hemisphäre ist in 4 Großhirnrindenlappen geteilt
Die Großhirnrinde als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
Corpus callosum (Balken)
- dicker Nervenstrang
- verbindet die beiden Hemisphären
Das Corpus callosum als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
Gyrus cinguli
- liegt dorsal zum Corpus callosum
- Emotion
- Schmerzempfindung
- Kognition
Insula
- Emotion
- Homöostase
- Geschmacksempfinden
Die Insula als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
Basalganglien
- bestehend aus
- dorsales Striatum
- Nucleus caudatus
- Capsula interna (im Erwachsenenalter)
- Putamen
- Globus pallidus (nicht zu verwechseln mit Pallidum)
- bildet zusammen mit Substantia nigra Pars reticularis die wichtigste Ausgangsstation der Basalganglien
- dorsales Striatum
- regelt
- Bewegungsausführung
- implizites Gedächtnis
- motorisches Lernen
- Gewohnheitslernen
Die Basalganglien als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
Hippocampus
- regelt das explizite Gedächtnis
- Erinnerung für Menschen, Orte, Dinge, Geschehnisse
Der Hippocampus als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
Amygdala
- koordiniert die autonome und endokrine Reaktion auf emotionale Zustände
- einschließlich des Angstgedächtnisses (Teil des impliziten Gedächtnisses)
Die Amygdala als 3-D-Animation bei dasGehirn.info.
Anatomisch lassen sich weiter unterscheiden:
Weiße Substanz
- die myelinhaltigen Nervenfasern
- verlaufen unterhalb der Rinde
Graue Substanz
- Ansammlungen von Nervenzellkörpern
- im lebenden Gehirn rosa
- im toten Gehirn grau
Das limbische System als 3-D-Animation bei dasGehirn.info
9.2.3. Konnektom
Das Konnektom ist die Gesamtheit der Nervenverbindungen zwischen verschiedenen (Gehirn-)Strukturen.
10. Gehirnregionen und Funktionen - Hardware und Software
Zwar haben einzelne Gehirnregionen bevorzugte Funktionen, jedoch besteht keine eindeutige 1:1-Zuordnung.
Einfache Reflexe werden noch recht eindeutig durch bestimmte Gehirnregionen gesteuert. Je komplexer eine Verhaltensfunktion ist, desto mehr wird das Zusammenspiel mehrerer Gehirnregionen genutzt - hier spricht man von Gehirnnetzwerken.
Es hilft einem Individuum beim Überleben, wenn wichtige Funktionen alternativ von verschiedenen Gehirnregionen gesteuert werden können (Redundanz). Ausfallende Funktionen (z.B. wenn eine Gehirnregion durch einen Schlaganfall geschädigt wird) können dadurch auch durch andere Gehirnregionen übernommen werden (Flexibilität).
Ohne die Übernahme der Steuerung der beeinträchtigten Funktion durch eine andere Gehirnregion wäre es zwar möglich, die Verschlechterung oder den Totalausfall einer Funktion durch entsprechende Verlagerung der Überlebensstrategien auf eine verstärkte Nutzung anderer Fähigkeiten (Verhaltensänderung) auszugleichen. Es ist jedoch wesentlich einfacher, ein bereits als erfolgreich erlerntes Verhalten beizubehalten, indem wichtige Funktionen aufrechterhalten werden können, weil sie durch mehr als lediglich eine Gehirnregion repräsentiert werden und lediglich die Ansteuerung der Funktion neu erlernt werden muss.
Dies erklärt zugleich die Schwierigkeiten, bestimmte Funktionsbeeinträchtigungen auf Defekte bestimmter Gehirnregionen zurückzuführen. Dies betrifft insbesondere die Mechanismen, die keine spezifische Körperfunktion repräsentieren.
Die bei ADHS bestehenden Probleme betreffen eher Mechanismen zur langfristigeren Regulation von Verhaltensweisen und können nicht bestimmten Hardware-Defekten einzelner Gehirnregionen zugeordnet werden.
11. Kognition und Emotion, Gedanken und Emotionen
Analytisches Verständnis der Umwelt dient dazu, uns ein schematisches Abbild von ihr zu verschaffen. Dabei können wir uns nicht nur die Elemente, aus denen sich die Umwelt zusammensetzt, sondern auch die Mechanismen, wie diese Elemente untereinander agieren und sich beeinflussen, in unseren Gedanken vorstellen und in unserem Gedächtnis abspeichern.
Durch die Fähigkeit zur Abstraktion und zur Vereinfachung (Zusammenfassung von Elementen zu Gruppen mit gemeinsamen Eigenschaften und von Interaktionsmechanismen zu gemeinsamen Regeln) können wir sehr viel mehr Informationen speichern und Voraussagen über mögliche Zusammenhänge bilden, die wir im konkreten einzelnen Beispiel noch nicht selbst erlebt haben. Dadurch ist es nicht erforderlich, jede existierende Schlangenart einmal gesehen zu haben, um sie zu erkennen. Es reicht, die Eigenschaften von Schlangen zu kennen (länglich, keine Beine, häufig in Wald oder Feld. meist am Boden) um auch unbekannte Schlangen als solche zu erkennen. Ebenso reicht es, die Giftigkeit einiger von Ihnen zu kennen, um daraus ein Risiko bei einer noch nie gesehenen Schlangenart ableiten zu können.
Kognition und Analyse wird im Gehirn durch die jüngste Gehirnregion verarbeitet, den präfrontalen Kortex (PFC). Dessen analytische Sichtweise der Welt lässt sich vielleicht mit einem Blick durch ein Mikroskop vergleichen. Dieser Blick offenbart eine Unmenge an Details, die sehr viel mehr Schlussfolgerungen zulässt als ohne diese Vergrößerung.
Für eine Steuerung des eigenen Verhaltens ist ein so detaillierter Blick jedoch nur sehr eingeschränkt brauchbar. das gesamte Leben durch ständige Analyse zu steuern, wäre viel zu aufwendig. Es wären viel zu viele Daten, die gleichzeitig zu bewerten wären. So wertvoll ein Mikroskop ist, um Einzelheiten zu betrachten, so überfordernd wäre es, alle Informationen, die z.B. bei einem geselligen Abend in einer Kneipe gleichzeitig dadurch zu betrachten.
Würde der PFC alle Handlungen selbst steuern, wäre er völlig überlastet. Um dies zu vermeiden, speichern wir kognitiv gelernte Informationen (Wissen) und bewusst (unter Steuerungshoheit des PFC) ausgeübte Handlungen in Automatismen ab. Um eine Gewohnheit zu bilden, muss eine Handlung in der Regel 4 bis 6 Wochen geübt werden. Durch das Üben und Automatisieren wird die Handlungssteuerung vom PFC an andere, posteriore, Gehirnregionen übergeben. Ist eine Gewohnheit einmal gebildet, ist eine Handlung einmal automatisiert, kann sich der PFC anderen Aufgaben widmen und neues Wissen schaffen.
Automatismen und Gewohnheiten sind dann jedoch nicht frei von jeder Steuerung. Ihre Steuerung ist allerdings weit weniger diffizil und detailliert. Dieser Steuerungsmechanismus sind unsere Emotionen. Emotionen reagieren sehr schnell, aber auch sehr grob. Emotionen lenken das Individuum unterbewusst in Richtung sicherer Bereiche.
Werden Emotionen stärker, z.B. weil etwas besonders Schönes oder Problematisches passiert, werden sie spürbar. Gefühle (die körperliche Wahrnehmung von Emotionen) melden dem Bewusstsein die Emotionen und schaffen die Möglichkeit einer kognitiven Einflussnahme.
Je besser die Automatismen trainiert sind, je mehr bewusste Korrekturen und Erweiterungen sie erfahren haben, desto besser können sie die Anforderungen an das Individuum decken. Menschen, die sich viele Jahre mit einem bestimmten Bereich des Lebens beschäftigt haben, die lange geübt und die Ergebnisse ihrer gefühlsgesteuerten (hypothetischen oder ausgeführten) Handlungen immer wieder einer Kontrolle durch das Mikroskop des PFC unterzogen und Korrekturen zur Verbesserung der Ergebnisse vorgenommen haben, haben in diesem Bereich sehr gut trainierte Automatismen – eine geschärfte Intuition. Spezialisten in anspruchsvollen Berufen (Ärzte, Techniker, Juristen, Mathematiker) kennen es gut, etwas beurteilen zu sollen, und das Gefühl zu haben: “Nach den bekannten Regeln müsste das so und so laufen. Aber hier stimmt etwas nicht…”, ohne dass sie sofort begründen könnten, was es ist. Erst nach einiger kognitiver, analytischer Beschäftigung mit der Sache wird ihnen bewusst, welche Besonderheit vorliegt, die ein Abweichen von den allgemeinen Regeln erfordert.
Automatisierung ist die Folge von dicht ausgebildeten synaptischen Verbindungen. Cells that fire together, wire together. Das gemeinsame Feuern wird zuerst kognitiv gesteuert. Ist es lang genug erfolgt, verbinden sich die dabei aktiven Gehirnneuronen untereinander, sodass sie weniger kognitiver Anleitung benötigen, um gemeinsam zu feuern.
Die Herstellung von synaptischen Verbindungen zwischen Neuronen und deren gemeinsames Feuern wird durch LTP (Long term potentiation) gefördert. LTP stellt das neuronale Korrelat von Lernen dar. Die LTD (Long term depression) unterstützt dagegen dabei, Gewohnheiten wieder zu beenden, Automatismen zu stoppen (grob formuliert: Vergessen) - indem Verbindungen zwischen Neuronen geschwächt und ihr gemeinsames Feuern gehemmt werden.
12. Konditionierung
12.1. Klassische Konditionierung
Zusammen mit einem unkonditionierten Reiz (z.B. Nahrung), der eine unkonditionierte Reaktion auslöst (z.B. Speichelfluss), wird wiederholt ein neutraler (eigentlich irrelevanter) Reiz (z.B. ein Glockenton) präsentiert.
Durch die klassische Konditionierung wird der neutrale Reiz mit der unkonditionierten Reaktion verbunden, sodass nach einigen Wiederholungen der neutrale Reiz (Glocke) die zuvor unkonditionierte Reaktion (Speichelfluss) auslöst, und damit zur konditionierten Reaktion wird (hier: Pawlowscher Reflex).
Konditionierung benötigt in der Regel:
- häufige Wiederholungen
- Gleichzeitigkeit unkonditionierter und neutraler Reiz (zeitliche Kontiguität)
Ausnahme z.B.: konditionierte Geschmacksaversion, konditioniertes defensives Vergraben
12.2. Operante Konditionierung
Verstärkung (durch angenehme Reize) oder Abschwächung (durch unangenehme Reize) einer zufällig auftretenden Handlung (z.B. Tastendruck)
12.3. Konditionierte Geschmacksaversion
Für Lebewesen ist es wichtig, Nahrung zu vermeiden, die unverträglich, giftig und krankheitserregend ist,
Viele Lebewesen sind neophob, vermeiden also neue Erfahrungen, um Risiken zu minimieren.
Nagetiere probieren von unbekannten Lebensmitteln nur geringe Mengen. Werden sie danach krank, vermeiden sie diese Lebensmittel künftig, auch wenn die Krankheit nicht von dem Lebensmittel kausal ausgelöst wurde. Dafür genügt bereits eine einmalige Erfahrung/Konditionierung.
Beim Menschen kann z.B. eine Übelkeit aufgrund einer Chemotherapie oder übermäßigen Alkoholkonsums eine Vermeidung von zuvor konsumierten Lebensmitteln auslösen.4
12.4. Konditioniertes defensives Vergraben
Gegenstände, die Nagetieren durch leichte Schocks Angst machen, lösen bei diesen einen Reflex aus, den Gegenstand zu vergraben.
Beispiel: Röhrchen, das knapp über dem streubedeckten Boden aus der Wand ragt und mit einem Luftstoß oder einem üblen Geruch Angst auslöst, wird mit einem Haufen Streu bedeckt.
13. Bildgebende Verfahren
13.1. Computertomographie (CT)
Die CT ist ein röntgenbasiertes Schichtbildverfahren. Schnell, weitverbreitet, hilfreich bei akuten Blutungen oder Schädelverletzungen.
13.2. Magnetresonanztomographie (MRT / MRI)
Die strukturelle MRT nutzt Magnetfelder und Radiowellen zur Darstellung von Weichteilen. Sie hat eine hohe Auflösung und keine Strahlenbelastung.
Spezielle MRT-Techniken sind:
- Diffusions-Tensor-MRT (DWI)
- identifiziert Bahnen, an denen Wassermoleküle schneller diffundieren
- dies erfolgt erhöht entlang Nervenbahnen (Axonenbündeln)
- Perfusions-MRT
- MR-Angiographie (MRA)
- Traktographie (DTI)
13.3. Funktionelle MRT (fMRT)
Die fMRT misst Änderungen des Sauerstoffgehalts im Blut (BOLD-Signal), meist zur Darstellung aktiver Hirnareale z. B. bei Sprache, Bewegung oder Handlungsplanung.
Niedrige zeitliche Auflösung von 2 bis 3 Sekunden, daher in neurologischen Dimensionen sehr ungenau.
13.4. Funktionelle Nah-Infrarot-Spektroskopie (fNIRS)
Andere Namen für NIRS: Nah-Infrarot-Bildgebung (NIRI, Near-Infrared Imaging), Diffuse optische Bildgebung (DO!, Diffuse optical imaging), Diffus-optische Tomographie (DOT, Diffuse Optical Tomography), Nah-Infrarot-Tomographie (NIT, Near Infrared Tomography), Nah-Infrarot-Neurobildgebung (NIN, Near Infrared neuroimaging), Ereignisbezogene optische Signale (EROS, Event-related optical signals).
Die fNIRS ähnelt der fMRT, ist jedoch ein optisches bildgebendes Verfahren. fNIRS misst den Blut-Sauerstoffgehalt im Gehirn durch die Schädeldecke.
Infrarotes Licht (zwischen 600 und 1000 nm) kann biologisches Gewebe relativ gut durchdringen. Da oxygeniertes und desoxygeniertes Hämoglobin im selben Spektralbereich spezifische Absorptionsspektren haben, kann fNIRS Änderungen in der Konzentration des oxygenierten und desoxygenierten Bluts in bestimmten Hirnarealen messen und daraus die Aktivität dieser Gehirnareale abbilden.
Die zeitliche und räumliche Auflösung ist zwar schlechter als die eines EEG, jedoch ist es frei von Störsignalen durch Kabel.
13.5. Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
Die PET nutzt radioaktiv markierte Substanzen (Tracer) zur Darstellung des Stoffwechsels, insbesondere bei der Diagnostik von Tumoren, Demenz oder Alzheimer.
13.6. Single-Photon-Emission-Computertomographie (SPECT)
SPECT ist ein nuklearmedizinisches Schnittbildverfahren, mit dem funktionellen Stoffwechselvorgänge in Organen dreidimensional darstellt werden können. Nach Gabe eines radioaktiv markierten Tracers wird dessen Verteilung im Körper mit einer rotierenden Gammakamera erfasst und zu Schichtbildern verarbeitet.
13.7. SPECT-CT
SPECT-CT ergänzt SPECT, indem die funktionellen SPECT-Bilder mit den anatomischen CT-Bildern fusioniert werden, was die Präzision der Lokalisierung erhöht.
13.8. Ultraschall (Sonographie)
Hochfrequenter Schall wird genutzt, um anhand der unterschiedlichen Reflektion durch verschiedene Gewebearten und Knochen ein nichtinvasives Bild zu erhalten.
13.9. Angiographie (digitale Subtraktionsangiographie, DSA)
DSA ist ein invasives Verfahren mit Kontrastmittelgabe.
Goldstandard zur Gefäßdarstellung (z. B. bei Aneurysmen, Stenosen).
13.10. Myelographie
Die Myelographie ist eine Röntgendarstellung des Rückenmarks unter Zuhilfenahmen von Kontrastmitteln in den Liquorraum. Sie wurde weitgehend durch die MRT abgelöst.
14. Physiologische Messverfahren
14.1. Elektrokardiographie (EKG)
Messung und Aufzeichnung des Summenvektors der elektrischen Aktivitäten von Herzmuskelfasern.
14.2. Elektroenzephalographie (EEG)
Das EEG misst die elektrische Gesamtaktivität des Gehirns durch auf der Kopfhaut angebrachte Elektroden.
Daneben gibt es auch invasive EEG-Verfahren, die jedoch nur in speziellen Fällen und in der Forschung relevant sind.
14.3. Magnetoenzephalographie (MEG)
Die MEG misst Veränderungen der Magnetfeldern auf der Kopfhaut. Diese bilden Muster schädeldeckennaher neuronaler Aktivität ab.
Die räumliche Auflösung ist höher als die eines EEG.
Die Abbildung subkortikaler Aktivität ist zuverlässiger als die eines EEG.
Leider ist die MEG sehr teuer und aufgrund der notwendigen Bewegungslosigkeit der Patienten nur begrenzt einsetzbar.
14.4. Elektromyographie (EMG)
EMG ist das Standardverfahren zur Messung der Muskelspannung.
14.5. Elektrookulographie (EOG)
Messung der Augenbewegungen sowie Veränderungen des Ruhepotentials der Retina. Darstellung in Form eines Elektrookulogramms.
Bei ruckartigen horizontalen Augenbewegungen können rechts und links um das Auge elektrischen Spannungsschwankungen von der Haut abgeleitet werden. Die Höhe dieser Potenzialschwankungen bzw. deren Zunahme beim Übergang nach einer 12-minütigen Dunkelanpassung zu einem hellen Umfeld repräsentiert die Funktion bestimmter Netzhautschichten, insbesondere des Pigmentepithels.
15. Pharmakologische Messverfahren
15.1. Immunocytochemie
Durch speziell konstruierte Antikörper, die nur auf bestimmte einzelne Neuropeptide reagieren, und die mit Farbstoffen oder radioaktiven Markern verbunden sind, lassen sich die betreffenden Neuropeptide im Gehirn orten.
Da nur diejenigen Neuronen, die einen Neurotransmitter produzieren, auch die für dessen Synthese benötigten Enzyme beinhalten, lassen sich mittels Antikörper für neurotransmitterspezifische Enzyme die jeweiligen Neuronen markieren, z.B. noradrenerge Neurone durch Antikörper für Dopamin-beta-Hydroxylase, die Dopamin zu Noradrenalin umwandelt.4
15.2. In-situ-Hybridisierung
Alle Peptide und Proteine werden auf Strängen von Messenger-RNA (mRNA) auf der Basis von Nukleotidbasensequenzen synthetisiert. Für viele Neuroproteine sind die Nukleotidbasensequenzen bekannt, sodass die Hybridstränge von mRNA mit den komplementären Basensequenzen künstlich hergestellt werden können.
Bei der In-situ-Hybridisierung werden nun Hybrid-RNA-Stränge mit der Basensequenz, die komplementär zu der das Zielneuroprotein synthetisierenden mRNA ist, mit einem Farbstoff oder einem radioaktiven Tracer markiert. In Gehirnschnitten binden die eingebrachten markierten Hybrid-RNA-Stränge an die komplementären mRNA-Stränge und markieren so die Position derjenigen Neuronen, die das Zielprotein synthetisieren.
15.3. Chemische Läsion
Manche Stoffe wirken nur auf ganz bestimmte Neuronen giftig. So wird das Neurotoxin 6-OHDA (6-Hydroxydopamin) nur von noradrenergen und dopaminergen Neuronen aufgenommen, was eine selektive chemische Abtötung dieser Neuronen ermöglicht. Axone anderer Neuronen, die durch das intoxikierte Gebiet laufen, bleiben dabei unversehrt.
15.4. 2-Desoxyglukose
2-Desoxyglukose (2-DG) besitzt eine ähnliche chemische Struktur wie Glukose. Aktive Neuronen absorbieren daher mehr 2-DG als inaktive Neuronen, ohne sie metabolisieren zu können, sodass sich 2-DG in ihnen anreichert. Wird 2DG radioaktiv markiert, kann es zur Erkennung von Neuronen verwendet werden, die in bestimmten Konstellationen (Verhaltensaufgaben) aktiv sind.
16. Gentechnik
16.1. Gen-Knockout
Beim Gen-Knockout werden einzelne Gene mittels Gene-Targeting vollständig abgeschaltet. Dazu werden manipulierte embryonale Stammzellen in die Keimbahn eingebracht.
16.2. Gen-Knockin
Beim Gen-Knockin wird eine neue oder veränderte DNA-Sequenz in das Genom eingefügt, indem manipulierte embryonale Stammzellen in die Keimbahn eingebracht werden.
Dadurch können Gene eingefügt oder durch andere Genvarianten ersetzt werden.
16.3. Gen-Editierung
CRISPR/Cas9 (CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; CAS: CRISPR-associated) ist eine molekularbiologische Methode, mit der DNA gezielt geschnitten und verändert werden kann. Durch CRISPR/Cas können Gene eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet und Nukleotide in einem Gen geändert werden. Ebenso kann das Epigenom verändert werden.
16.4. Optogenetik
Gezielte De-/Polarisation von Neuronen durch Opsine. Opsine (Kanalrhodopsine) sind Ionenkanäle, die sich auf Licht öffnen.
17. Aufnahmeformen von Medikamenten
Pharmakologische Substanzen (Medikamente) können auf viele verschiedene Weisen verabreicht werden:32
- enteral (durch den Verdauungstrakt)
- parenteral (außerhalb des Verdauungstrakts)
- vermeiden den First-Pass-Effekt des hepatischen Metabolismus, wie er bei oraler Einnahme häufig auftritt
- erzeugen daher in der Regel eine höhere Bioverfügbarkeit
- vermeiden unvorhersehbare Effekte, die mit enteralen Absorptionsprozessen verbunden sind
- vermeiden den First-Pass-Effekt des hepatischen Metabolismus, wie er bei oraler Einnahme häufig auftritt
- oral (in den Mund)
- direkt in den Magen (Magensonde)
- intravenös (in ein Blutgefäß)
- epikutan (auf die Haut)
- intradermal (in die Haut)
- subkutan (unter die Haut)
- transdermal (durch die Haut, z.B. Pflaster)
- intramuskulär (in den Muskel)
- transkorneal (auf das Auge)
- intraokular (oder in das Auge)
- intrazerebral (in das Gehirn)
- epidural (in den Raum, der die Dura mater umgibt)
- intrathekal (in den Raum, der das distale Rückenmark umgibt);
- intraossär (in die Knochenmarkshöhle)
- intranasal (in die Nase gesprüht zur Aufnahme über die Nasenschleimhäute oder die Lunge)
- intratracheal (in die Lunge durch direkte tracheale Instillation oder Inhalation)
Die verschiedenen Verabreichungsformen haben einen eigenen Einfluss auf die Wirkung, da die Absorptionsgeschwindigkeit und der Abbau von Substanzen von der Art der Gabe abhängen kann.
18. Versuchsaufbauten für Tierversuche
Die folgenden Modelle beschreiben typische Versuchsaufbauten für Nagetieren.
18.1. Open Field
Die Versuchstiere werden in eine geräumige, leere Kammer gesetzt.
Ängstliches Verhalten korreliert mit
- wenig Bewegung
- viel Aufenthalt an den Rändern/Wänden
- Vermeidung der freien Raummitte
- seltenes Aufrichten (rearing)
- seltenes Putzen (grooming)
- erhöhtes Koten (Bolusabgabe)
18.2. Elevated Plus Maze
Labyrinth in 50 cm Höhe über dem Boden mit 4 Armen in Form eines Pluszeichens. Zwei Arme haben Seitenwände, die anderen beiden keine.
Ängstliches Defensivverhalten korreliert mit
- der Zeit, die in den geschlossenen, geschützten Armen verbracht wird, im Verhältnis zur Zeit in den offenen Armen
18.3. Morris-Wasserlabyrinth
Das Morris-Wasserlabyrinth (Morris water maze) ist ein mit milchigem Wasser gefülltes Becken, dessen Wassertiefe so groß ist, dass Nagetiere darin schwimmen müssen. In dem Becken befindet sich dicht unter der Wasseroberfläche eine durch das trübe Wasser nicht erkennbare Plattform, deren Ort im Becken verändert werden kann.
Nagetiere werden in das Wasser gesetzt und müssen so lange schwimmen, bis sie die Plattform finden. Bei Wiederholungen finden sie die Plattform schneller, solange diese sich an derselben Stelle befindet,
Der Versuchsaufbau dient zur Messung der Orientierungsfähigkeit.
18.4. Radialarmlabyrinth
Ein Radialarmlabyrinth besteht aus acht oder mehr gleich aussehenden Armen, die im gleichen Abstand voneinander im Kreis von der Startposition wegzeigen. An den Enden der Arme können Nahrungsmittel platziert werden.
An Nagetieren wird ihre räumliche Orientierung und ihr Erinnerungsvermögen in Bezug auf bereits besuchte leere oder leergefressene Arme getestet. Durch Drehen des Labyrinths kann die Orientierung im Raum erschwert werden.
19. Neuropsychologische Tests und was sie messen
| Variable33 | Aufgabe/Test | Was gemessen wird misst |
|---|---|---|
| Nback-Score | EN-Back-Aufgabe | Arbeitsgedächtnis |
| Listensortierung | Toolbox-Listen-Sortier-Arbeitsgedächtnis-Test | Arbeitsgedächtnis, Informationsverarbeitung |
| Flanker-Kosten-Effekt | Toolbox-Flanker-Aufgabe | Aufmerksamkeit, Hemmung |
| Flanker | Toolbox-Flanker-Aufgabe | Aufmerksamkeit, Hemmung automatischer Reaktionen |
| Bild | Toolbox-Bildsequenz-Gedächtnistest | Episodisches Gedächtnis, Sequenzierung |
| Kartensortierung | Toolbox-Dimensionsänderungs-Kartensortier-Aufgabe | Exekutive Funktionen |
| Muster | Toolbox-Mustervergleichs-Verarbeitungsgeschwindigkeitstest | Informationsverarbeitung |
| SST-Score | Die Stopp-Signal-Aufgabe | Reaktionshemmung |
| Bild-Vokabeln | Toolbox-Bildvokabular-Aufgabe | Sprache |
Pissadaki EK, Bolam JP (2013): The energy cost of action potential propagation in dopamine neurons: clues to susceptibility in Parkinson’s disease. Front Comput Neurosci. 2013 Mar 18;7:13. doi: 10.3389/fncom.2013.00013. PMID: 23515615; PMCID: PMC3600574. ↥
Rostain (2015): The Neurobiology of ADHD, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania ↥ ↥
Fan X, Agid Y (2018): At the Origin of the History of Glia. Neuroscience. 2018 Aug 10;385:255-271. doi: 10.1016/j.neuroscience.2018.05.050. PMID: 29890289. REVIEW ↥
Pinel J, Barnes SJ, Pauli P, Gamer M (2024): Biopsychologie, Pearson, 11. Auflage ↥ ↥ ↥
Dury LC, Yde Ohki CM, Lesch KP, Walitza S, Grünblatt E (2025): The role of astrocytes in attention-deficit hyperactivity disorder: An update. Psychiatry Res. 2025 Aug;350:116558. doi: 10.1016/j.psychres.2025.116558. PMID: 40424648. REVIEW ↥ ↥
Physiologie.cc: Synapsen german ↥ ↥
Munk (2008): Taschenlehrbuch Biologie: Biochemie – Zellbiologie. Seite 453 ↥
Llinás R, Steinberg IZ, Walton K (1981): Presynaptic calcium currents in squid giant synapse. Biophys J. 1981 Mar;33(3):289-321. doi: 10.1016/S0006-3495(81)84898-9. PMID: 7225510; PMCID: PMC1327433. ↥
Böhm (2020): Neurotransmission und Neuromodulation, S. 113, 114 in “Mediatoren und Transmitter”, in Freissmuth, Offermans, Böhm (2020): Pharmakologie und Toxikologie – Von den molekularen Grundlagen zur Pharmakotherapie, 3. Aufl. ↥
Pinel J, Barnes SJ, Pauli P, Gamer M (2024):Biopsychologie, Pearson, 11. Auflage ↥
Cools, D’Esposito (2011): Inverted-U shaped dopamine actions on human working memory and cognitive control; Biol Psychiatry. 2011 Jun 15; 69(12): e113–e125. doi: 10.1016/j.biopsych.2011.03.028; PMCID: PMC3111448; NIHMSID: NIHMS286132 REVIEW ↥
Levy (2009): Dopamine vs Noradrenaline: Inverted-U Effects and ADHD Theories; Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, Vol 43, Issue 2, 2009 ↥
Aston-Jones G, Cohen JD (2005):An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance. Annu Rev Neurosci. 2005;28:403-50. doi: 10.1146/annurev.neuro.28.061604.135709. PMID: 16022602. ↥
Weber, Conlon, Stutt, Wendt, Ten Eyck, Narayanan (2022): Quantifying the inverted U: A meta-analysis of prefrontal dopamine, D1 receptors, and working memory. Behav Neurosci. 2022 Apr 7. doi: 10.1037/bne0000512. PMID: 35389678. ↥
Vijayraghavan S, Wang M, Birnbaum SG, Williams GV, Arnsten AF (2007): Inverted-U dopamine D1 receptor actions on prefrontal neurons engaged in working memory. Nat Neurosci. 2007 Mar;10(3):376-84. doi: 10.1038/nn1846. PMID: 17277774. ↥
Choi JY, Jang HJ, Ornelas S, Fleming WT, Fürth D, Au J, Bandi A, Engel EA, Witten IB (2020): A Comparison of Dopaminergic and Cholinergic Populations Reveals Unique Contributions of VTA Dopamine Neurons to Short-Term Memory. Cell Rep. 2020 Dec 15;33(11):108492. doi: 10.1016/j.celrep.2020.108492. PMID: 33326775; PMCID: PMC8038523. ↥
[Hinghofer-Szalkay: Humoral-neuronale Steuerung und Kontrolle von Organsystemen: Azetylcholin, Amine, Purine, Peptide, lokale Mediatoren] ↥
Hinghofer-Szalkay: Eine Reise durch die Physiologie - Wie der Körper des Menschen funktioniert. Humoral-neuronale Steuerung und Kontrolle von Organsystemen. Synapsen. ↥
Redmond WJ, Cawston EE, Grimsey NL, Stuart J, Edington AR, Glass M, Connor M (2016): Identification of N-arachidonoyl dopamine as a highly biased ligand at cannabinoid CB1 receptors. Br J Pharmacol. 2016 Jan;173(1):115-27. doi: 10.1111/bph.13341. PMID: 26398720; PMCID: PMC4813372. ↥
Tsao P, von Zastrow M (2000): Downregulation of G protein-coupled receptors. Curr Opin Neurobiol. 2000 Jun;10(3):365-9. doi: 10.1016/s0959-4388(00)00096-9. PMID: 10851176. REVIEW ↥
von Zastrow M (2003): Mechanisms regulating membrane trafficking of G protein-coupled receptors in the endocytic pathway. Life Sci. 2003 Dec 5;74(2-3):217-24. doi: 10.1016/j.lfs.2003.09.008. PMID: 14607249. REVIEW ↥
Hanyaloglu AC, von Zastrow M (2008): Regulation of GPCRs by endocytic membrane trafficking and its potential implications. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2008;48:537-68. doi: 10.1146/annurev.pharmtox.48.113006.094830. PMID: 18184106. REVIEW ↥
DocCheck Flexikon: Aktionspotential. Abgerufen 30.12.23 ↥
Lu HC, Mackie K (2016): An Introduction to the Endogenous Cannabinoid System. Biol Psychiatry. 2016 Apr 1;79(7):516-25. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.07.028. PMID: 26698193; PMCID: PMC4789136. REVIEW ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Straiker A, Mackie K (2005): Depolarization-induced suppression of excitation in murine autaptic hippocampal neurones. J Physiol. 2005 Dec 1;569(Pt 2):501-17. doi: 10.1113/jphysiol.2005.091918. PMID: 16179366; PMCID: PMC1464237. ↥
Kellogg R, Mackie K, Straiker A (2009): Cannabinoid CB1 receptor-dependent long-term depression in autaptic excitatory neurons. J Neurophysiol. 2009 Aug;102(2):1160-71. doi: 10.1152/jn.00266.2009. PMID: 19494194; PMCID: PMC2724344. ↥ ↥
Kandel, Shadlen (2021): The Brain and Behaviour. In: Kandel, Koester, Mack, Siegelbaum (2021): Principles of Neuronal Science. ↥
Das Gehirn: Der Cortex german ↥
Turner PV, Brabb T, Pekow C, Vasbinder MA (2011): Administration of substances to laboratory animals: routes of administration and factors to consider. J Am Assoc Lab Anim Sci. 2011 Sep;50(5):600-13. PMID: 22330705; PMCID: PMC3189662. REVIEW ↥
Zhao Y, Wang Y, Liu Y (2025): An Integrative Approach for Subtyping Mental Disorders Using Multi-modality Data. medRxiv [Preprint]. 2025 May 28:2025.05.27.25328416. doi: 10.1101/2025.05.27.25328416. PMID: 40492098; PMCID: PMC12148268. ↥