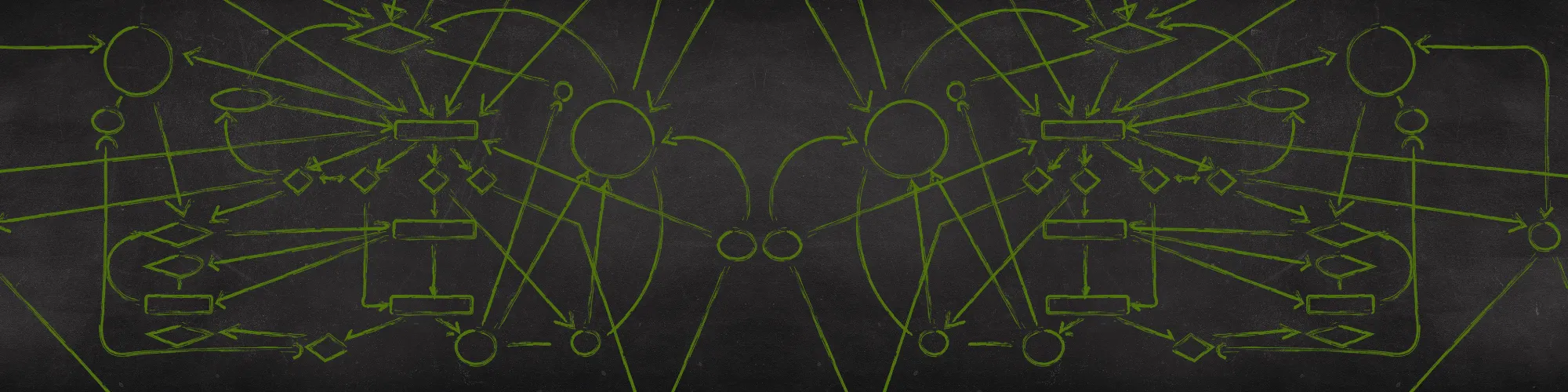MPH Teil 2: Dosierung, Nebenwirkung, Kontraindikationen
66 % der Kinder vom ADHS-HI und ADHS-C-Subtyp benötigen eine moderate bis hohe Dosierung.12
Wichtig seien insbesondere “die letzten 10 mg”, um eine optimale Wirkung zu erzielen.3
Bei der Dosierungseinstellung sollte daher nicht zu früh mit der Dosierungssteigerung aufgehört werden. Emotionale Verarmung (“Zombie”) ist Zeichen einer Überdosierung.
Erwachsene benötigen eine deutlich geringere Dosierung, da sich die Anzahl der DAT (Dopamintransporter) mit dem Alter verringert. Die Anzahl der DAT halbiert sich bei 50-Jährigen gegenüber 10-Jährigen, bei Erwachsenen empfiehlt sich eine Einstiegsdosierung von max. 5 mg alle 3 Stunden (unretardiert).
Die Halbwertszeit von MPH beträgt:4
- bei Kindern ca. 2,5 Stunden
- bei Erwachsenen ca. 3,5 Stunden
- 6. Dosierung von MPH
- 6.1. MPH nicht pauschal nach Gewicht oder Alter
- 6.2. Tagesabdeckung MPH
- 6.3. Dosierungseinstellung von Methylphenidat
- 6.4. Nebenwirkungen bei der Einstellung auf Methylphenidat
- 6.5. Überdosierungssymptome bei MPH
- 6.6. Auch bei Wirkung von MPH, erst recht bei Nebenwirkung / Nonresponding verschiedene MPH-Medikamente ausprobieren
- 6.7. Begleitumstände der Einstellung und Einnahme
- 6.8. Wirkung bei Nichtbetroffenen
- 6.9. MPH im Seniorenalter
- 6.10. Internationale Leitlinien zur Behandlung mit Methylphenidat
- 6.10.1. USA: AAP-Leitlinien, 2011, 219
- 6.10.2. Kanada: CADDRA-Leitlinien/CAP-Leitlinien, 2011
- 6.10.3. Australien: NHMRC-Leitlinien, 2012, 2023
- 6.10.4. Neuseeland: Leitlinien des neuseeländischen Gesundheitsministeriums, 2001
- 6.10.5. Malaysia: Malaysische Leitlinien, 2008, 2020
- 6.10.6. Europa: ESCAP-Leitlinien, 2004
- 6.10.7. Deutschland: S3-Leitlinie, 2018
- 6.10.8. Großbritannien: BAP-Leitlinien, 2007, 2014
- 6.10.9. England und Wales: NICE-Leitlinien, 2016, 2018
- 6.10.10. Schottland: SIGN-Leitlinien, 2009
- 6.10.11. Spanien: Spanische Leitlinien, 2010
- 6.10.12. Schweden: Schwedische Leitlinien (2016)
- 7. Retardiertes oder unretardiertes MPH
- 8. Trägersubstanzen
- 9. Wirkungsqualität von Methylphenidat
- 10. Nebenwirkungen von Methylphenidat
- 10.1. Nebenwirkungen
- 10.1.1. Keine schwere Nebenwirkungen (- 9 %)
- 10.1.2. Leicht erhöhtes Risiko leichter Nebenwirkungen (+ 29 %)
- 10.1.3. Keine ernsthaften Nebenwirkungen bei dauerhafter Einnahme
- 10.1.4. Häufige Nebenwirkungen
- 10.1.5. Nebenwirkungen vornehmlich bei komorbider Angst oder anderen Komorbiditäten
- 10.1.6. Genvarianten mit erhöhtem MPH-Nebenwirkungsrisiko
- 10.2. Längenwachstum kurzzeitig verzögert
- 10.3. Parkinson / Tremor im Alter
- 10.4. Psychoserisiko allenfalls leicht erhöht
- 10.5. Anorexierisiko erhöht
- 10.6. Krampfschwelle, EEG-Auffälligkeiten
- 10.7. Anregung bestehender Angststörungen, Depression, Aggression
- 10.8. MPH und Manierisiko bei Bipolarer Störung
- 10.9. MPH erhöht Histamin
- 10.10. Rebound
- 10.11. MPH und Narkose / Anästhesie
- 10.12. Sonstiges zu Nebenwirkungen von MPH
- 10.13. Keine erhöhten kardiovaskulären Risiken
- 10.14. Leberschädigungen nicht bekannt
- 10.15. Keine negativen Langzeitwirkungen von MPH
- 10.16. Verringertes Risiko von Stressfrakturen
- 10.17. Verringertes Risiko von Typ 2 Diabetes
- 10.1. Nebenwirkungen
- 11. Wechselwirkungen und Kontraindikationen
6. Dosierung von MPH
Zur Eindosierung von MPH und Stimulanzien siehe ausführlich unter Eindosierung von Medikamenten bei ADHS
6.1. MPH nicht pauschal nach Gewicht oder Alter
Methylphenidat wird nicht pauschal “nach Körpergewicht” dosiert. Es gibt Betroffene, die mit sehr geringen Dosen MPH (3 bis 5 mg alle 3 Stunden) auskommen. Andere benötigen die maximal empfohlene Dosis von 1 mg/kg Körpergewicht am Tag.
Die Maximaldosis von 1 mg/kg Körpergewicht und Tag gilt vornehmlich für Kinder. Eine umfassende Metastudie von 28 Kohortenstudien an 5524 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren, bei denen die passende MPH-Dosis stufenweise ermittelt wurde, berichtet eine Bandbreite von 0,8 mg / kg / Tag bis 1,8 mg / kg / Tag.5 Bei Betroffenen, die MPH gut vertragen und mit niedrigeren Dosen lediglich eine moderate Wirkung erzielen, kann auch eine Dosierung von mehr als 1 mg/kg/Tag getestet werden.6
Eine Studie berichtet eine große Variabilität der optimalen Dosishöhe (hier anhand von OROS-MPH):7
- 7,9 % mit 18 mg
- 29,3 % mit 36 mg
- 34,4 % mit 54 mg
- 19,8 % mit 72 mg
- 8,7 % mit 90 mg
Eine andere Studie fand für Kinder und Jugendliche als optimale Dosis von retardiertem MPH:8
- 1,5 % mit 10 mg
- 2,0 % mit 15 mg
- 16,8 % mit 20 mg
- 27,7 % mit 30 mg
- 25,2 % mit 40 mg
- 17,8 % mit 50 mg
- 8,9 % mit 60 mg
Eine klinische Studie verglich feste und flexibler Dosierung bestätigte die Vorteile einer individuell angepassten Dosis.910
Blutspiegel von MPH variieren individuell sehr stark zur eingenommenen MPH-Dosis.11 Die individuell unterschiedliche Wirkung wird unter anderem auf genetisch bedingte Metabolisierungsunterschiede zurückgeführt.1213
Bei Erwachsenen (mit höherem Körpergewicht) ist die erforderliche Tagesdosis in der Regel deutlich niedriger.
geringere Dosierung bei Erwachsenen
Erwachsene verfügen über weitaus weniger Dopamintransporter und benötigen daher idR weniger MPH als Kinder. Eine Dosierung wie bei Kindern kann bei Erwachsenen daher bereits eine Überdosierung darstellen. Daher ist bei Erwachsenen eine noch langsamere Eindosierung in noch niedrigeren Schritten (Steigerung 2,5 mg bis max. 5 mg unretardiert / Tag, alle 4 Tage) empfehlenswert. Eine Überdosierung kann genau die Symptome verursachen, die eigentlich vermieden werden sollen, da der optimale Dopaminspiegel bereits überschritten ist, was sehr ähnliche Signalübertragungsprobleme verursacht wie der ADHS-typische zu niedrige Dopaminspiegel. Bei einer höheren Dosierung (über 60 mg / Tag) berichten einzelne Neurologen von Anpassungseffekten (nicht statistisch abgesichert).
Betroffene mit der ADHS-I-Präsentationsform und noch mehr ASS-Betroffene scheinen besonders häufig niedrigere Dosen zu benötigen.
Wir kennen mehrere Fälle von betroffenen Erwachsenen, die mit einer Einzeldosis von 1,25 mg unretardiertem MPH optimal dosiert sind.
6.2. Tagesabdeckung MPH
Empfehlenswert ist auf jeden Fall, MPH so einzusetzen, dass der gesamte Tag abgedeckt wird, nicht aber der spätere Abend und die Nacht.
Details
MPH nur einmalig (morgens) für 3 (unretardiert) oder 6 Stunden (retardiert) zu nehmen, bewirkt, dass der Betroffene danach seiner Stressempfindlichkeit wieder ausgeliefert ist. In den letzten Stunden vor dem Schlafengehen sollte MPH mit Vorsicht benutzt werden. Die meisten Menschen reagieren mit Schlafproblemen. Einigen ermöglicht eine Viertel bis halbe Stimulanziendosis dagegen gerade das Einschlafen, weil es das Gedankenkreisen abstellt. Möglicherweise könnte eine niedrige Dosis unretardierter Stimulanzien bei denjenigen Personen hilfreich sein, die ohnehin ein niedriges Arousal haben. Dies sind Menschen, denen es z.B. hilft, wenn im Hintergrund ein Radio oder ein Fernseher läuft, um sich besser konzentrieren zu können. Anderen hilft es, Hörbücher zu hören, um einschlafen zu können. Menschen mit einem hohen Arousal benötigen eher absolute Ruhe, um sich konzentrieren zu können.
Zur unterschiedlichen Wirkungsdauer der einzelnen MPH-Medikamente siehe unten unter 7.
6.3. Dosierungseinstellung von Methylphenidat
6.3.1. Langsame Eindosierung in kleinen Schritten
Eine langsame und geduldige Eindosierung ist wichtig. Die in Deutschland übliche Eindosierungspraxis ist unserer Auffassung nach deutlich zu schnell.
Grundsätzlich sollte MPH zu Testbeginn niedrig dosiert und die Dosierung nur langsam erhöht werden. Selbst wenn die optimale Dosierung bekannt wäre, würde eine sofortige optimale Dosierung möglicherweise eine Überforderung bewirken14 und Nebenwirkungen forcieren.15
Die Dosierungseinstellung sollte mit 2,5 mg bis maximal 5 mg/3–4 Stunden beginnen, die erst innerhalb der ersten Tage auf 3 x 5 = 15 mg / Tag ausgedehnt werden. Tests mit höheren Startdosierungen brachten nicht nur keine besseren, sondern sogar schlechtere Wirksamkeitsergebnisse und bewirkten zugleich eine deutlich höhere Abbruchrate aufgrund Nebenwirkungen.15 Andere empfehlen 2,5 bis 5 mg zweimal täglich, bei einer wöchentlichen Steigerung von 2,5 bis 5 mg.616141517 Da so kleinteilige Eindosierungsstufen den anderen Betroffenen nicht schaden (sondern im Gegenteil Eindosierungsnebenwirkungen vermeiden helfen),18 sollten Dosierungsschritte in 2,5-mg-Schritten (bezogen auf eine unretardierte MPH-Einzeldosis) der Goldstandard sein. So auch Kühle.17 In dieselbe Richtung weist eine große Metastudie.19 Andere Quellen empfehlen einen Start mit 1-2 Einzeldosen zu 5 mg und eine wöchentliche Steigerung der Einzeldosis in 5 mg-Schritten.20 Aus den genannten Gründen halten wir diese Dosissprünge bereits für zu groß.
Für Betroffene, bei denen bereits extrem kleine Dosisunterschiede entscheidend sind, bietet eine Apotheke in der Schweiz MPH-Tropfen an. Ein Tropfen enthält 0,35 mg MPH. Es wird in Chargen hergestellt und mittels E216 und E218 konserviert.21 Eine Betroffene berichtet, dass ein Auflösen von unretardiertem MPH in Alkohol in so exakter Menge, dass diese per Tropfen abgemessen werden konnten, ein vergleichbares Ergebnis zeigte.
- Betroffene und (eingeweiht) beobachtende Dritte über Wirkdauer des jeweiligen Präparats und zu erwartenden Rebound aufklären.
- Wir halten eine Aufdosierung alle 5 bis 7 Tage um 2,5 mg je Einzeldosis für sinnvoll. Dosierungsschritte von 5 mg / Einzeldosis, wie wir sie früher hier für akzeptabel hielten, halten wir inzwischen für zu hoch, weil es einen relevanten Anteil an Betroffenen gibt, für die 2,5 mg weniger eine Unterdosierung und 2,5 mg mehr eine Überdosierung bedeuten.17 Auch wenn dies nur eine Minderheit der Betroffenen darstellt, wäre es ein Kunstfehler, schneller aufzudosieren, da nie vorausgesehen werden kann, zu welcher Gruppe ein Betroffener gehört. Sieh hierzu auch unten: Genvarianten beeinflussen MPH-Dosierung.
Je jünger ein Betroffener ist und je weniger er von der MPH-Dosis überhaupt merkt, desto eher können die Aufdosierungssprünge erhöht werden.
Im Laufe der Einstellung wird die Dosis so lange erhöht, bis die Merkmale einer Überdosierung mit der nächsten und übernächsten Dosissteigerung verstärkt werden. Danach kann die Dosis bestimmt werden, die die Symptome optimal reduziert, ohne Nebenwirkungen zu verursachen.
Es sind leider Fälle bekannt, in denen Ärzte die Einstellung mit Einzeldosen von 15 oder 20 mg begonnen haben. Wir raten hiervon dringend ab.
Selbst wenn für einige wenige Betroffene dies die richtige Dosierung wäre, wäre auch für sie bei einer solch hohen Einstiegsdosierung in den ersten Wochen das Risiko deutlich erhöht, erheblich stärkere Nebenwirkungsprobleme zu erleiden als bei einer langsameren Einstellung.
6.3.2. Kein Koffein bei MPH-Eindosierung
Koffein (Thein ist ebenfalls Koffein), Theobromin (dunkler Kakao) und andere Stimulanzien sollten bei der Eindosierung unbedingt vermieden werden. Koffein, das zuvor problemlos vertragen wurde, kann bei gleichzeitiger Einnahme von Stimulanzien plötzlich eine innere Zittrigkeit und andere Beschwerden auslösen, die dann fehlerhaft als Medikamentennebenwirkung fehlinterpretiert werden kann. Bei Neueindosierung von Stimulanzien kann Koffein ein Empfinden wie eine Überdosierung auslösen. Sind die Stimulanzien einmal eindosiert, kann Koffein wieder probiert werden. Missempfindungen können dann korrekt dem Koffein zugeordnet werden.
6.3.3. Kein Nikotinentzug bei MPH-Eindosierung
Ein zeitgleich mit der Eindosierung begonnener Nikotinentzug kann das Ergebnis verfälschen. Häufig sinkt mit der Stimulanzien-Einnahme das Bedürfnis nach Zigaretten von selbst.
Ebenso sollte der Neubeginn einer Nikotinaufnahme während der Stimulanzien-Eindosierung vermieden werden.
6.3.4. Altersbedingte Dosierungsunterschiede
Da Erwachsene deutlich weniger Dopamintransporter haben als Kinder (50-Jährige haben nur noch halb so viele wie 10-Jährige,22 ist bei Erwachsenen eine wesentlich geringere Dosierung angezeigt als bei Kindern.
Mehr hierzu unter ⇒ Eindosierung von Medikamenten bei ADHS.
6.3.5. Genvarianten beeinflussen MPH-Spiegel
Ein kleiner Anteil der Betroffenen benötigt eine deutlich geringere Dosierung an MPH.
Der CES1-Polymorphismus Gly143Glu wurde in 5,8 % der ADHS-Betroffenen und 4,1 % der Bevölkerung gefunden. Unter 441 Kindern fand sich kein Fall von CES1 Glu143Glu (homozygot).
CES1 Gly143Glu zeigte eine unveränderte Verringerung von Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität-Impulsivität auf MPH.
Träger der CES1 143Glu-Variante (5,56 %), benötigten um knapp 30 % niedrigere MPH-Dosen zur Symptomreduktion.23
Mehr zum Einfluss der CES1-Genvarianten auf die Wirkung von MPH unter Einflüsse auf Wirkstärke von MPH im Beitrag MPH Teil 3: Abbau, Wirkstärke.
6.4. Nebenwirkungen bei der Einstellung auf Methylphenidat
In den ersten Tagen kann die Einnahme mit dem Gefühl verbunden sein, als wäre Schnee gefallen – alles ist in Watte gepackt. Dieser (meist sehr angenehm empfundene) Eindruck rührt von dieser Reduzierung der Reizüberflutung her und verschwindet wie die meisten Nebenwirkungen innerhalb weniger Tage.
Andere beschreiben den Anfangseffekt mit der den beeindruckenden Erfahrung, dass erstmals im Leben der Kopf ruhig ist und die Gedanken sich nicht überschlagen.
Selten treten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schlafprobleme oder weitere auf. Die meisten Nebenwirkungen legen sich innerhalb der ersten Wochen nach der Eindosierung. Das Risiko derartiger Nebenwirkungen kann durch eine (wie oben beschriebene) sehr langsame Eindosierung erheblich reduziert werden.15 Eine Studie mit individuell flexibler Dosisanpassung berichtet eine mit 2,3 % weit unterdurchschnittliche Rate von Teilnahmeabbrüchen aufgrund von Nebenwirkungen[{Ginsberg Y, Arngrim T, Philipsen A, Gandhi P, Chen CW, Kumar V, Huss M (2014): Long-term (1 year) safety and efficacy of methylphenidate modified-release long-acting formulation (MPH-LA) in adults with attention-deficit hyperactivity disorder: a 26-week, flexible-dose, open-label extension to a 40-week, double-blind, randomised, placebo-controlled core study. CNS Drugs. 2014 Oct;28(10):951-62. doi: 10.1007/s40263-014-0180-4. PMID: 25183661; PMCID: PMC4676085.}} im Vergleich zu Studien mit fixer Dosisvorgabe, die dort teils bis 18,5 % betrug.13
Bislang hat keine uns bekannte Studie an Erwachsenen ausdrücklich den Konsum von Koffein bei der Eindosierung untersagt. Da Koffein bei der Eindosierung die Nebenwirkungsquote drastisch erhöht, dürfte sich die Nebenwirkungsrate bei einem konsequenten Unterlassen einer Koffeineinnahme im Vergleich zu den Studienergebnissen deutlich verringern.
Kopfschmerzen können zuweilen durch ausreichendes Trinken und regelmäßiges Essen (ggf. Traubenzucker) verringert oder vermieden werden. Da Stimulanzien das Hungergefühl verringern, kann dies zu einer verringerten Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme beitragen, die Kopfschmerzen mitverursachen kann.
Eine Studie fand, dass MPH keine Schlafprobleme verursachte. Dies könnte von den Ergebnissen anderer Studien möglicherweise deshalb abweichen, weil diese Studie mit 16 Wochen relativ lang andauerte, sodass die Eingewöhnungsnebenwirkungen nicht mehr spürbar waren.24 Eine kleine Studie, die lediglich 14 Tage betrachtete, fand dagegen eine verringerte Schlafdauer und ein verspätetes Einschlafen bei Kindern, die mit retardiertem MPH behandelt wurden.25
Ein höherer Blutdruckanstieg bei der ersten MPH-Dosis korrelierte mit einer besseren ADHS-Symptomverringerung nach 6 Monaten.26
6.5. Überdosierungssymptome bei MPH
Bei einer passenden Dosierung von MPH nimmt die Konzentrationsfähigkeit zu und der innere Druck und eine ggf. vorhandene Hyperaktivität nehmen ab. Steigen letztere diese bei erhöhter Dosierung wieder an, ist dies ein Zeichen für eine zu hohe Dosierung.
Methylphenidat schließt den (bei ADHS-Betroffenen zu weit offenen) Reizfilter. Typische Reaktion von Betroffenen mit passender Dosierung ist, dass sie zu sich selbst kommen, dass sie mehr sie selbst sind.
Stellt der Betroffene fest, dass MPH ihn hibbelig macht (obwohl weder Koffein (Thein ist nur ein anderer Name für Koffein) oder Theobromin (dunkler Kakao) konsumiert wird), sollte gleichwohl zunächst noch vorsichtig weiter gesteigert werden. Es wurde mehrfach beobachtet, dass derartige Nebeneffekte nach einigen Tagen oder auf der nächsthöheren Dosis wieder verschwanden. Bleibt diese Zittrigkeit, ist die Dosierung zu hoch. Das gilt ebenso, wenn die Konzentration zu stark wird, also der Reizfilter zu weit eingeschränkt wird. Eingeschränkte Emotionalität (“Zombie-Effekte”) ist ein deutlicher Hinweis auf eine Überdosierung.
Eine Studie an Affen kam zu dem Ergebnis, dass geringe Dosen von MPH Impulsivität reduzieren, während höhere Dosen sedierend wirken.27
Dies schließt an die empirischen Erfahrungen an, dass ADHS-Betroffene, insbesondere Kinder, unter MPH zuweilen apathisch wirken können. Dies deutet im Anschluss an diese Studie auf eine Überdosierung hin.
Aripiprazol war bei Ratten in der Lage, eine Überdosierung durch MPH zu verringern.28 Dies ist umso erstaunlicher, als Aripiprazol ein starker CES1-Inhibitor ist, mithin den Abbau von MPH verringert.294
6.6. Auch bei Wirkung von MPH, erst recht bei Nebenwirkung / Nonresponding verschiedene MPH-Medikamente ausprobieren
Viele Betroffene berichten, dass sie mit dem einem MPH-Präparat Nebenwirkungen erleiden, die sie bei einem anderen MPH-Präparat nicht haben. Diesseits sind Berichte bekannt, dass ein MPH-Präparat (hier: Medikinet) keine Wirkung zeigte, während ein anderes (hier: Concerta) gut ansprach.
Andere Betroffene berichten, dass sie auf ein Präparat (hier: Concerta) mit erhöhten Aggressionen zu kämpfen hatten, was bei einem anderen MPH-Präparat (Medikinet oder unretardiertes MPH) nicht auftrat.
Wieder andere spüren bei Medikinet einen stärkeren Reboundeffekt (Unruheanstieg im Moment des Abklingens der Wirkung) als bei anderen MPH-Präparaten.
Die verschiedenen MPH-Präparate zeigen sehr unterschiedliche zeitliche Abläufe der Wirkstofffreisetzung .Zudem wird MPH je nach Hersteller in verschiedene Trägerstoffe eingebettet.
Bei einer bestehenden Glutenunverträglichkeit ist in Weizenstärke eingebettetes MPH naturgemäß untauglich. Vergleichbares kann sich in Bezug auf Laktoseunverträglichkeit ergeben.
Bleibt eine befriedigende Wirkung bei allen MPH-Präparaten aus (die typische Nonresponderrate beträgt knapp 30 %), sollte stets eine Medikation mit Amphetamin-Medikamenten erfolgen. Dadurch können von den MPH-Nonrespondern weitere 70 bis 80 % zufriedenstellend medikamentiert werden, sodass die Gesamtnonresponderrate von MPH und AMP auf unter 10 % sinkt.
Bei einer fortbestehenden Dysthymie oder Depression trotz befriedigender Wirkung von MPH im Übrigen kann ebenfalls ein Wechsel zu Amphetaminmedikamenten angedacht werden, da diese zugleich leicht serotonerg wirken.
Antidepressive Wirkungen wurden bei MPH-Tagesdosen von 10 bis 30 mg und bei AMP-Tagesdosen von 5 bis 60 mg beobachtet.6
6.7. Begleitumstände der Einstellung und Einnahme
Manche Betroffene benötigen ihre MPH-Medikamente immer exakt zur gleichen Zeit.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Einnahme so erfolgt, dass der gesamte Tag abgedeckt ist. Die letzten Dosen des Tages müssen aber so zeitig genommen werden, dass zur Schlafenszeit keine Wirkung mehr besteht.
Details
Während der Einstellung auf MPH sollten Koffein (Kaffee, Schwarztee), Theobromin (dunkler Kakao) und Alkohol komplett gemieden werden, da diese die Wirkung von Stimulanzien verstärken können. Etliche Betroffenen berichten, dass sie durch MPH wesentlich empfindlicher auf derartige Stimulanzien reagieren. Eine Hibbeligkeit kann daher durch Koffein ausgelöst werden, während dieselbe Menge Koffein ohne MPH keine solche Wirkung hatte. Wie Antidepressiva verursacht MPH in den ersten Tagen oder Wochen der Einnahme häufig leichte Nebenwirkungen (Mundtrockenheit etc.), die sich recht bald legen.
Um Appetitlosigkeit vorzubeugen oder abzumildern, empfiehlt sich eine Einnahme zu oder nach den Mahlzeiten.
6.8. Wirkung bei Nichtbetroffenen
MPH kann auch bei nicht ADHS-Betroffenen wirken. Es kann (in geringer Dosierung) die Aufmerksamkeit erhöhen, so wie leichter Stress durch eine leichte Anhebung von Noradrenalin und Dopamin im PFC die kognitive Leistungsfähigkeit erhöht.
Eine höhere Dosierung bei Nichtbetroffenen (wie eine geringe Dosierung bei Menschen, die einen ohnehin schon leicht erhöhten Dopamin- oder Noradrenalinspiegel besitzen) kann eine so starke Überhöhung der DA und NE-Spiegel bewirken, dass hierdurch ADHS-Symptome hervorgerufen werden.
Bei ADHS ist der (tonische) Dopaminspiegel im Striatum zu gering, was etliche ADHS-Symptome verursacht. MPH erhöht den Dopaminspiegel im Striatum bei richtiger Dosierung auf das optimale Level. Wird der Dopaminspiegel jedoch über das optimale Level hinaus erhöht – durch Überdosierung bei ADHS-Betroffenen oder bei Einnahme von MPH bei Gesunden – löst diese dieselben Symptome aus, wie bei ADHS, weil die Neurotransmitterkommunikation nur bei dem richtigen Neurotransmitterspiegel optimal funktioniert.30
Auch Amphetaminmedikamente wirken (in niedriger Dosierung) bei nicht betroffenen männlichen Mäusen positiv:31
- Fehlalarme bei Männchen und Weibchen signifikant verringert
- Trefferquote bei Weibchen verringert
- im Ergebnis Leistung im CPT (nur) bei Männchen verbessert
- Orientierung und körperliches Engagement bei den Aufgabenreizen unbeeinträchtigt
Der Dopaminanstieg auf Amphetamin-Gabe im dorsalen Striatum (nicht aber im Nucleus accumbens) ist bei männlichen wie weiblichen Ratten höher, wenn diese zuvor chronischem unkontrollierbarem Stress ausgesetzt waren. Dies könnte auf eine abweichende dopaminerge Reaktion auf Stimulanzien (ADHS-Medikamente) bei Betroffenen von chronischem Stress wie von ADHS hindeuten.32
Eine frühkindliche Gabe von MPH in Medikamentendosis wie in Überdosis erhöhte bei Ratten ohne ADHS Entzündungsmarker, angstähnliches Verhalten und die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke., Bei SHR (ADHS-Modelltier) erfolgte dies nur bei Überdosis, während die Medikamentendosis nicht nur das Verhalten, sondern auch die Entzündungswerte verbesserte.33
6.9. MPH im Seniorenalter
Eine ausdrückliche Einschränkung der Zulassung von Methylphenidat im Seniorenalter existiert nicht. In den MPH-Arzneimittelinformationen findet sich der Hinweis, dass MPH an ältere Menschen nicht vorschrieben werden soll. Bei Lisdexamfetamin existiert ein solcher Hinweis trotz ebenso unzureichender Datenlage nicht.
Eine Behandlung mit MPH in höheren Alter soll gleichwohl eine off-label Verordnung darstellen können.34
Es bestehen keine Hinweise darauf, dass MPH im Alter Schwierigkeiten bereiten würde.
Eine kleine Studie berichtet eine gute Verträglichkeit bei älteren Betroffenen.35
Zudem wird MPH auch bei Altersdepression eingesetzt.36
6.10. Internationale Leitlinien zur Behandlung mit Methylphenidat
6.10.1. USA: AAP-Leitlinien, 2011, 219
“Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents”, Leitlinie der American Academy of Pediatrics3738
Kinder, Jugendliche:
Beginn: mit niedriger Dosis, insbesondere bei Kindern, da sie das Medikament langsamer verstoffwechseln und unterschiedlich darauf ansprechen
Erhöhung in 7-Tages-Schritten (in dringenden Fällen in 3-Tages-Schritten)
Ziel: Dosis mit optimaler Wirksamkeit und minimalen Nebenwirkungen.
Dosierungsstufen nennt diese Leitlinie nicht.
Bei behandlungsresistenten Fällen auch Kombinationsmedikation.
6.10.2. Kanada: CADDRA-Leitlinien/CAP-Leitlinien, 2011
Kinder, Jugendliche, Erwachsene:39
Beginn mit niedrigen Medikamentendosen, langsame Dosiserhöhung, bis zu der Dosis, die die Symptome und die Funktionsfähigkeit verbessert und ein gutes Nebenwirkungsprofil aufweist.
6.10.3. Australien: NHMRC-Leitlinien, 2012, 2023
Kinder, Jugendliche, Erwachsene:40
Gemeinsame Auswahl der passenden Medikamente durch Ärzte und Betroffene / Erziehungsberechtigte.
Individuell passende Medikationsauswahl
Dosistitration unter regelmäßiger ärztlicher Überprüfung der Fortschritte in Bezug auf Symptome, Funktionsniveaus und unerwünschter Wirkungen
Optimale Dosis: Dosis, bei der die Symptome reduziert und die funktionellen Ergebnisse verbessert werden, bei minimalen unerwünschten Wirkungen
6.10.4. Neuseeland: Leitlinien des neuseeländischen Gesundheitsministeriums, 2001
Die neuseeländischen Leitlinien scheinen nicht frei im Internet verfügbar zu sein. Es finden sich lediglich Wiedergaben mit unklarem Copyright.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene:
Dosierung beginnend am unteren Ende des Dosisbereichs (etwa 0,1 bis 0,2 mg/kg MPH oder 0,05 bis 0,1 mg/kg DAMP).
Individuelle Titration nach Bedarf
Tempo der Titration nach Intensität des Behandlungseffekts und der Nebenwirkungen
Optimale Dosis: kleinste Dosis für ein optimales therapeutisches Ansprechen
Höchstdosis:
- MPH: 60 mg/Tag für Jugendliche und Kinder
- AMP: 20 mg/Tag jüngere Kinder; 40 mg/Tag ältere Kinder
Bei ausbleibender Verbesserung
- Einhaltung des Medikamentenregimes überprüfen
- Dosierung anpassen
- Wirkstoff wechseln
Medikationsbehandlung mit Stimulanzien (MPH oder Dextroamphetamin) ist erste Wahl.
Weitere Interventionen (auch Verhaltenstherapie) nur, soweit nach einigen Monaten optimal titrierter Medikation noch Bedarf hierfür besteht.
6.10.5. Malaysia: Malaysische Leitlinien, 2008, 2020
Kinder, Jugendliche, Erwachsene:41
Beginn mit Dosis am unteren Ende des Dosisbereichs
- 2,5 mg/Tag bei 3-5 Jahren
- 5 mg/Tag bei 8 Jahren
- 10 mg/Tag bei mehr als 8 Jahren
Ziel: höchste Wirksamkeit bei minimalen Nebenwirkungen
Höchstdosis:
- 60 mg/Tag
- 30 mg/Tag, im Alter von 3-5 Jahren
6.10.6. Europa: ESCAP-Leitlinien, 2004
Kinder, Jugendliche, Erwachsene:42
Beginn mit niedriger Dosis (0,2 mg/kg/Dosis für Kinder und Jugendliche)
Erhöhung, bis gutes Ergebnis erzielt wird, oder unerwünschte Wirkungen auftreten, oder Höchstdosis erreicht ist (0,7 mg/kg/Dosis für Kinder und Jugendliche) - je nachdem, was zuerst eintritt
6.10.7. Deutschland: S3-Leitlinie, 2018
Kinder, Jugendliche, Erwachsene:43
Beginn: niedrige Einstiegsdosis
Titration: 10 mg-Titrationsschritten von halbtagesretardiertem MPH
Erhöhung, bis keine weitere klinisch signifikante Verbesserung der Symptomatik (z.B. auf der Ebene der Kernsymptome, aber auch im Sinne einer Änderung von Problemverhalten) zu erreichen ist und die unerwünschten Wirkungen tolerabel bleiben
Ziel: möglichst niedrige Dosierung
In der Leitlinie 2009 hieß es:“Bei Stimulanzien: Keine strenge Korrelation zwischen Körpergewicht und notwendiger Dosis!(Evidenzgrad IIa). Immer individuelle Titration. Die angegebenen mg/kg KG sind Durchschnittswerte und können individuell unter- oder überschritten werden.”44
MPH:
Während die Leitlinien bei MPH eine Eindosierung in 10 mg-Titrationsschritten von halbtagesretardiertem MPH vorsehen, halten wir mit Kühle eine halb so schnelle Titration für sinnvoll - auch wenn diese die Geduld mancher Betroffener herausfordert. Hierfür kann unretardiertes MPH (2,5 mg / Einzeldosis) oder retardiertes MPH (5 mg / Einzeldosis, was aufgrund der doppelten Wirkdauer 2 nacheinander genommenen Dosen von 2,5 mg unretardiertem MPH entspricht) verwendet werden.
6.10.8. Großbritannien: BAP-Leitlinien, 2007, 2014
Kinder, Jugendliche, Erwachsene:4546
Titration auf die optimale Dosis über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen
Höchstdosis:
- 60 mg/Tag für Jugendliche und Kinder
- 100 mg/Tag für Erwachsene
Bei behandlungsresistenten Fällen auch Kombinationsmedikation.
6.10.9. England und Wales: NICE-Leitlinien, 2016, 2018
Kinder, Jugendliche:47
Erstbehandlung beginnend mit niedrigen Dosen
- unretardiert 5 mg zwei- oder dreimal täglich, oder
- retardiert
Titration in Abhängigkeit von den Symptomen und Nebenwirkungen über 4-6 Wochen bis zur Dosisoptimierung
Höchstdosis: 60 mg/Tag
Erwachsene:
Erstbehandlung beginnend mit niedrigen Dosen
- unretardiert 5 mg dreimal täglich
- retardiert: entsprechende Dosis
Titration in Abhängigkeit von den Symptomen und Nebenwirkungen über 4-6 Wochen bis zur Dosisoptimierung
Höchstdosis: 100 mg/Tag
6.10.10. Schottland: SIGN-Leitlinien, 2009
Diese Leitlinie wurde 2019 zurückgezogen. Es wird stattdessen auf die NICE-Leitlinie 2018 verwiesen.48
Kinder, Jugendliche:49
Strukturiertes Titrationsprotokoll zur Ermittlung der optimalen Medikamentendosis
6.10.11. Spanien: Spanische Leitlinien, 2010
Kinder, Jugendliche:50
Beginn mit niedrigen Dosen unretardierten MPHs (2,5 oder 5 mg je nach Gewicht; 2 bis 3 Mal täglich, nicht später als 17 Uhr)
Schrittweise Erhöhung um 2,5 bis 5 mg pro Woche, je nach klinischem Ansprechen und Nebenwirkungen
Dosisbandbreite: 0,5 bis 2 mg/kg/Tag
Höchstdosis: 60 mg/Tag
6.10.12. Schweden: Schwedische Leitlinien (2016)
Die “Swedish Medical Products Agency ADHD drugs – treatment guide-lines” scheinen nicht öffentlich verfügbar zu sein. Wiedergabe nach Huss et al.13
Kinder, Jugendliche:
Beginn mit niedrigen Dosen (18 mg bei lang wirksamen Medikamenten; 5-10 mg bei mittellang wirksamen Medikamenten)
Schrittweise Anpassung (ca. einmal pro Woche)
Ziel: Dosis, die gute Wirkung zeigt und gut vertragen wird
Erwachsene:
Klinikern wird empfohlen, die Behandlung mit einer niedrigen Dosis zu beginnen und diese schrittweise (in der Regel wöchentlich) auf eine Dosis zu erhöhen, die das beste Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Nebenwirkungen bietet (Höchstdosis bis zu 80 mg/Tag)
Beginn mit niedrigen Dosen
Schrittweise Anpassung (ca. einmal pro Woche)
Ziel: Dosis mit bestem Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Nebenwirkungen
Höchstdosis: 80 mg/Tag
7. Retardiertes oder unretardiertes MPH
Dieser Abschnitt wurde verschoben nach Retardiertes MPH, Retardtechniken im Beitrag MPH Teil 3: Retardierung
8. Trägersubstanzen
9. Wirkungsqualität von Methylphenidat
Methylphenidat ist das Mittel erster Wahl für Kinder. Es bekämpft die Symptome von ADHS deutlich besser als eine einjährige Verhaltenstherapie. Erst nach 3 Jahren Verhaltenstherapie werden vergleichbare Wirkungen erreicht.
Da Stimulanzien die Lern- und Therapiefähigkeit herstellen oder erhöhen, ist es sinnvoll, zunächst akut mit Stimulanzien zu arbeiten, um parallel dazu mittels Verhaltenstherapie und/oder Neurofeedback die Basis zu schaffen, um diese wieder absetzen zu können.
Die mittlere Effektstärke von MPH bei ADHS liegt zwischen 0,9 und 1,3.
Zur Wirksamkeit einzelner Medikamente und Behandlungsformen siehe ⇒ Effektstärke verschiedener Behandlungsformen von ADHSim Kapitel⇒ Behandlung und Therapie.
Eine MPH-Medikation in Kombination mit noradrenergen Medikamenten oder Zink kann die Wirkung weiter verbessern. Hier ist jedoch vorsichtige Herangehensweise empfohlen. Es empfiehlt sich, hierzu einen Arzt mit Erfahrung in Medikation bei ADHS heranzuziehen.
10. Nebenwirkungen von Methylphenidat
Bei einer passenden Dosierung vermittelt die Wirkung von MPH ADHS-Betroffenen das Gefühl, dass sie wesentlich mehr sie selbst sind als zuvor. Sollte ein Betroffener das Gefühl haben, durch Stimulanzien weniger er selbst zu sein, ist dies ein ernst zu nehmender Hinweis auf eine Fehldosierung, Fehlanwendung oder Fehldiagnose.
Studien zu Nebenwirkungen von ADHS‑Medikamenten sollten stets daraufhin geprüft werden, welche Dosen und welche Verabreichungsform verwendet wurden. Natürlich verursachen Stimulanzien ab bestimmten Dosen Nebenwirkungen. Alles, was wirkt, kann auch Nebenwirkungen zeigen. Bei über Medikamentendosis ansteigender Dosis nehmen diese naturgemäß ebenfalls zu. Die Dosis macht das Gift.
Während Medikamentendosen selbst bei Nichtbetroffenen leichte Vorteile zeigen, sind höhere Dosen naturgemäß schädlich.51
,
10.1. Nebenwirkungen
10.1.1. Keine schwere Nebenwirkungen (- 9 %)
Eine Cochrane-Metastudie zu MPH bei Kindern (Durchschnittsalter 9,7 Jahre) fand bei MPH geringfügig weniger schwerer Nebenwirkungen als bei Placebo (OR = 0,91, k = 9, n = 1.532).52
10.1.2. Leicht erhöhtes Risiko leichter Nebenwirkungen (+ 29 %)
Eine Cochrane-Metastudie zu MPH bei Kindern (Durchschnittsalter 9,7 Jahre) fand bei MPH etwas mehr leichter Nebenwirkungen als bei Placebo (OR = 1,29, k = 21, n = 3.132).52
10.1.3. Keine ernsthaften Nebenwirkungen bei dauerhafter Einnahme
Ein systematischer Review fand keine ernsthaften Nebenwirkungen einer langfristigen MPH-Einnahme.53 Eine langfristige Einnahme verursachte keine cardiovaskulären Probleme.54
10.1.4. Häufige Nebenwirkungen
“Häufige” Nebenwirkungen von MPH
Häufig auftretende Nebenwirkungen von MPH können sein:
(Häufig: treten bei 1 bis 10 % auf; 90 bis 99 % der mit MPH medikamentierten Personen haben diese Nebenwirkungen nicht)
- Affektlabilität (Stimmungsschwankungen)
- Aggression
- Agitiertheit
- Alopezie (Haarausfall)
- Angst
- Anorexie (Gewichtsverlust, fehlende Gewichtszunahme)
- Eine umfassende Studie stellte einen etwas geringeren BMI bei Jungen mit ADHS durch MPH fest.55 Die Gewichtsverringerung durch MPH war in einer anderen Studie nur tendenziell und nicht statistisch signifikant feststellbar.56 Eine große Metaanalyse von 38 Kohortenstudien an 5524 Teilnehmern bis 18 Jahren fand Gewichtsabnahme mit einer OR von 5.11 im Vergleich zu Placebo.5
- anormales Verhalten
- Arrhythmie (Herzrhythmusstörungen; Herz schlägt zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig)
- Arthralgie (Gelenkschmerzen)
- Bauchschmerzen
- Depression
- Durchfall
- Dyskinesie (Störungen des Bewegungsablaufs)
- Erbrechen
- Hautausschlag
- Husten
- Hypertonie (Bluthochdruck)
- Eine umfassende Studie konnte keine Beeinträchtigung des Blutdrucks bei Jungen mit ADHS durch MPH feststellen.57
- Magenbeschwerden
- Mundtrockenheit
- Nasopharyngitis (Nasen- / Rachenentzündung)
- Palpitationen (subjektives Gefühl, dass das Herz zu schnell / zu stark / unregelmäßig schlägt)
- Pruritus (Juckreiz)
- psychomotorische Hyperaktivität
- häufig Anzeichen von Überdosierung
- Pyrexie (Fieber)
- Rachen- und Kehlkopfschmerzen
- Reizbarkeit
- Schlafprobleme
- Einschlafprobleme
- Hinweis auf zu späte Einnahme am Tag
- Tagesmüdigkeit
- Einschlafprobleme
- Schwindel
- Tachykardie (Herzfrequenz über 100 Schläge / Minute)
- Übelkeit
- Urtikaria (Nesselsucht)
- Wachstumsverzögerung unter längerer Anwendung bei Kindern.
Die meisten der genannten Nebenwirkungen sind unspezifisch und spielen in der Praxis keine große Rolle.58
Zur Einordnung empfiehlt sich ein Vergleich der Nebenwirkungen mit dem Beipackzettel von Aspirin oder SSRI.
Eine große Metaanalyse von 38 Kohortenstudien an 5524 Teilnehmern bis 18 Jahren fand als häufigste Nebenwirkungen Schlafprobleme (OR 4,66), Gewichtsabnahme (OR 5,11), Bauchschmerzen (OR 1,9) und Kopfschmerzen (bei 14 % der MPH-Einnehmer) im Vergleich zu Placebo.5 Schlafschwierigkeiten entstehen insbesondere bei der Eindosierung häufig durch eine zu späte Gabe am Tag. Eine sehr langsame Eindosierung kann helfen, Nebenwirkungen zu vermeiden. Die meisten dieser Nebenwirkungen geben sich innerhalb der ersten Wochen.
Manchen Betroffenen hilft die Gabe einer geringen unretardierten Dosis (1/4 bis 1/2 einer Tageseinzeldosis) beim Einschlafen.6
Eine Studie, die 16 Wochen andauerte, fand, dass MPH keine Schlafprobleme verursachte.24 Eine kleine Studie, die lediglich 14 Tage betrachtete, fand dagegen eine verringerte Schlafdauer und ein verspätetes Einschlafen bei Kindern, die mit retardiertem MPH behandelt wurden.25 Dies deckt sich mit der Erfahrung, dass Schlafprobleme durch MPH möglich sind, aber in der Regel lediglich eine Eindosierungsnebenwirkung darstellen. Wir schließen daraus, dass im Falle von Schlafproblemen durch MPH während der ersten Wochen hilfreich sein könnte, die Tagesabdeckung zu verkürzen. Unabhängig davon empfiehlt sich stets eine langsame Eindosierung in Schritten von max. 2,5 mg / Einzeldosis unretardiertes MPH.
Eine Studie berichtet von einer statistisch signifikanten Erhöhung des Augeninnendrucks nur des linken Auges durch MPH bei ADHS. Eine Veränderung der Dicke der Makula-, Netzhautnervenfaserschicht (RNFL) oder Ganglienzellenschicht (GCL) wurde nicht berichtet.59
Die meisten Nebenwirkungen treten lediglich kurzfristig nach Beginn der Medikation auf und verschwinden regelmäßig innerhalb der ersten vier Wochen. Das jeweils kurzzeitige Gefühl einer trockenen / pelzigen Zunge kurz nach der Einnahme könnte länger anhalten, geht dafür recht zuverlässig irgendwann weg.
Ticstörungen werden bei Überdosierung beobachtet. Wenn Betroffene über Monate das Gefühl haben, dass die Welt sich entfernt oder das Leben eintönig wird, ist dies ebenfalls ein deutlicher Hinweis auf Überdosierung.
10.1.5. Nebenwirkungen vornehmlich bei komorbider Angst oder anderen Komorbiditäten
Mehrere Untersuchungen konstatierten, dass Nebenwirkungen auf Stimulanzien vornehmlich bei Betroffenen mit höheren Angstwerten und schnelleren Reaktionszeiten bzw. vorbestehenden Komorbiditäten auftreten.6061
Ein Zusammenhang mit EEG-Werten wurde nicht festgestellt.61
10.1.6. Genvarianten mit erhöhtem MPH-Nebenwirkungsrisiko
Eine erhöhtes Risiko bestimmter MPH-Nebenwirkungen fand sich bei bestimmten Genvarianten:62
- Appetitminderung: CES1*G
- Bukkal-linguale Bewegungen: 1065G
- Diastolischer Blutdruck: ADRA2A Mspl C/C-GC
- Emotionalität: DAT1*9/9
- Reizbarkeit: SNAP25 T1065G
- Zupfen: DRD47/DRD44
- sozialer Rückzug: DRD47/DRD44
- somatische Beschwerden: DAT1*10/10
- Tics: 5-HTTLRPS/LL/L und SNAP25 T1065G
- Traurigkeit: CES1*rsl12443580
- vegetative Symptome: 5-HTTLPR
10.2. Längenwachstum kurzzeitig verzögert
Mehrere umfassende Studien konnten keine andauernde Beeinträchtigung des Längenwachstums bei Jungen mit ADHS durch MPH feststellen.55
Eine zeitweilige Beeinträchtigung des Längenwachstums im ersten Jahr der MPH-Behandlung wurde im zweiten Jahr wieder aufgeholt.56 Eine zeitweilige Beeinträchtigung des Längenwachstums ist bei ADHS in der Kindheit häufig und wird in der Adoleszenz regelmäßig aufgeholt. Dies ist offenbar keine spezifische Auswirkung von Methylphenidat.63 Eine andere Studie fand ein 4-fach erhöhtes Risiko eines verringerten Längenwachstums und einer geringeren Gewichtszunahme bei Kindern mit ADHS im Alter von 8 und 10 Jahren. Die Länge der Stimulanzienbehandlung verstärkte dieses Risiko.64
10.3. Parkinson / Tremor im Alter
Eine sehr umfassende Studie analysierte die Wahrscheinlichkeit von Störungen aus dem Parkinson-Formenkreis (einfacher Tremor bis Parkinson) bei ADHS-Betroffenen mit und ohne Stimulanzieneinnahme über Jahrzehnte der Lebenszeit.65
Die Studie ist hinsichtlich der Ergebnisse höchst interessant:
- ADHS erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Parkinson(-ähnlichen) Störung auf Lebenszeit um das 2,4-fache
- Parkinson(-ähnliche) Störungen sind noch wahrscheinlicher, wenn die ADHS-Betroffenen Stimulanzien genommen hatten (6-fach)
- Parkinson(-ähnliche) Störungen sind bei ADHS-Betroffenen, die Methylphenidat bekamen, 8 mal so häufig wie bei Nichtbetroffenen
Dazu ist festzustellen:
- Das Ergebnis steht im Widerspruch zu einer späteren Langzeitstudie (siehe unten).
- Die Korrelation ist richtig
- Eine Kausalität ist fraglich
Ist Parkinson wahrscheinlicher bei Stimulanzien-Konsumenten oder bei schwererem ADHS, das häufiger mit Stimulanzien behandelt wird?
Eine Aussage hierüber lässt das Studiendesign nicht zu. Dafür wird es andere Untersuchungen benötigen. - Das erhöhte Komorbiditätsrisiko bei ADHS ist nicht auf Parkinson begrenzt.
Die Wahrscheinlichkeit eines frühen Todes ist bei unbehandeltem ADHS drastisch erhöht: von 0,8 % bei Nichtbetroffenen auf 2,3 % bei ADHS-Betroffenen, also plus 1,5 %-Punkte
Aufschlussreicher sind die absoluten Zahlen.
Eine Störung der Basalganglien oder des Cerebellums (eine mit Parkinson verwandte Störung (Tremor) oder Parkinson) bekamen
-
56 von 24.792 Nicht-ADHS-Betroffenen = 0,23 %
- davon 26 = 0,1 % mit weniger als 50 Jahren
- davon 19 = 0,08 % bekamen Parkinson
-
104 von 26,809 ADHS-Betroffenen bei denen nicht bekannt war, dass sie Stimulanzien erhielten = 0.39 %
- davon 69 = 0,26 % mit weniger als 50 Jahren
- davon 38 = 0,14 % bekamen Parkinson
-
62 von 4960 ADHS-Betroffenen, bei denen bekannt war, dass sie Stimulanzien erhielten = 1,25 %
- davon 42 = 0,85 % mit weniger als 50 Jahren
- davon 19 = 0,38 % bekamen Parkinson
60 % der Stimulanzien-Einnehmer hatten Amphetaminmedikamente, 40 % Methylphenidat erhalten. Wenn das Risiko bei allen Stimulantieneinnehmern 6-fach ist, und bei MPH, das von lediglich 40 % genommen wurde, 8-fach höher ist, muss es bei Amphetaminmedikamenten also ganz deutlich geringer als das 4-fache sein.
Das bedeutet: Das Risiko für eine Parkinson(verwandte) Störung könnte schätzungsweise betragen
- 1 % bei ADHS, behandelt mit Amphetaminmedikamenten
- 2 % bei ADHS, behandelt mit Methylphenidat
Man könnte also auch – genauso richtig – formulieren:
Das Risiko, innerhalb von 20 Jahren eine Parkinson(ähnliche) Störung zu bekommen, ist bei Menschen, die ADHS haben, um 0,16 %-Punkte erhöht (0,16 % mehr Menschen entwickeln eine Parkinson(ähnliche) Störung, wenn sie ADHS haben, als wenn sie es nicht haben). Werden Amphetaminmedikamente eingenommen, ist der Anstieg gegenüber Nichtbetroffenen um 1 %-Punkte erhöht, wird Methylphenidat verordnet, ist das Risiko um 2 %-Punkte erhöht.
Rechnet man das auf 100.000 Menschen um:
- 1,5 % von 100.000 sind 1.500 zusätzliche vorzeitige Tote durch ADHS
- 1 % von 100.000 sind 1.000 zusätzliche Betroffene von Störungen aus dem Parkinson-Formenkreis (von einem einfachen Tremor bis hin zu Parkinson) bei Amphetaminmedikamenten bei ADHS (ohne zu wissen, ob das an der Schwere des ADHS oder am AMP liegt).
- 2 % von 100.000 sind 2.000 zusätzliche Betroffene von Störungen aus dem Parkinson-Formenkreis (von einem einfachen Tremor bis hin zu Parkinson) bei Methylphenidat bei ADHS (ohne zu wissen, ob das an der Schwere des ADHS oder am MPH liegt).
Wenn aber jemand, der nun einmal ADHS hat, die Wahl hat,
- mit unbehandeltem ADHS das Risiko eines frühen Todes von 0,8 % auf 2,3 % zu verdreifachen (absolut: plus 1,5 %-Punkte)
- was Medikamente weitgehend beheben können
- oder für eine Behandlung ein erhöhtes Risiko für Störungen aus dem Parkinson-Formenkreis (von einem einfachen Tremor bis hin zu Parkinson) um das drei- bis achtfache, aber in absoluten Werten eben nur um 1 bis 2 %-Punkte in Kauf zu nehmen,
dürften es die meisten Menschen bevorzugen, lebend eine zitternde Hand zu haben, als tot eine ruhige.
Weiter folgt daraus, dass, sofern ADHS mit Amphetaminmedikamenten behandelbar ist, diese gegenüber MPH bevorzugt werden sollten.
Vor diesem Hintergrund klingt die Formulierung der Studienergebnisse etwas tendenziös bzw. aufmerksamkeitsheischend.
Das Studiendesign wäre perfekt, um darzustellen, wie viel höher die Sterblichkeit bei Medikation ist. Diese – sehr viel wichtigere Frage – wird indes nicht beantwortet, obwohl diese Daten die Autoren eigentlich geradezu angesprungen haben müssten. Ebenso wird nicht differenziert, dass bei Amphetaminmedikamenten das Risiko nur halb so stark erhöht war wie bei Methylphenidat, sondern es wurde ausschließlich die höhere Zahl von Methylphenidat genannt.
Die Erhöhung des Risikos für Störungen aus dem Parkinson-Formenkreis (von einem einfachen Tremor bis hin zu Parkinson) durch chronisch überdosiertes MPH könnte durch eine erhöhte Produktion von Chinonen und eine Verringerung von Glutathion (GSH, γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin) entstehen.66 Eine chronische Gabe von 10 mg MPH / kg (ca. das 10-fache der maximalen therapeutischen Menge beim Menschen) förderte einen Verlust dopaminerger Zellen in der Substantia nigra.67 Ein Verlust dopaminerger Zellen könnte Parkinsonsymptome erklären. Auch dies deutet darauf hin, dass eine hohe Dosierung von MPH möglichst vermieden werden sollte.
Eine deutsche Studie fand keinen Anhaltspunkt für eine Korrelation von Parkinson und Einnahme Psychostimulanzien wie Methylphenidat in der Kindheit.68
Eine weitere Langzeitstudie fand, dass bei ADHS eine Stimulanzienverschreibung das Parkinsonrisiko um 60 % verringerte.69
10.4. Psychoserisiko allenfalls leicht erhöht
Nach einer sehr großen Studie ist das Risiko, eine Psychose zu entwickeln, für ADHS-Betroffene, die MPH einnehmen, mit 0,10 % geringer als das derjenigen, die mit Amphetaminmedikamenten behandelt werden (0,21 %).70 Eine andere Studie fand ein ähnliches Verhältnis.71
Während mit Stimulanzien behandelte ADHS-Betroffene 2,4 Psychosefälle je 1000 Personenjahre (0,24 %) haben, sind es über die Gesamtbevölkerung 0,0214 %.72
Die Studien lassen keine Aussage darüber zu, ob die Erhöhung der Psychoseprävalenz auf das Bestehen der ADHS oder auf die Gabe von Stimulanzien zurückzuführen ist.
Eine weitere Studie fand ein 8-faches Risiko für ADHS-Betroffene bei der Einnahme von ADHS-Medikamenten (0,34 % vs. 0,048 %).73 Da dies nicht ADHS-Betroffene mit und ohne Medikamente, sondern ADHS-Betroffene mit Medikamenten gegen die Gesamtbevölkerung vergleicht, ist daraus keine belastbare Aussage über den Beitrag von ADHS-Medikamenten ableitbar. Das absolute Risiko für eine erstmalige Hospitalisierung wegen einer Psychose oder Manie bei einem Medikamentenbeginn war wirkstoffabhängig:
- Atomoxetin: 0,60 % (am höchsten)
- Amphetaminmedikamente: 0,33 %
- Methylphenidat: 0,19 %
Auf eine allenfalls leichte Risikoerhöhung durch Stimulanzien weist eine weitere große Kohortenstudie hin, die bei ADHS generell ein erheblich erhöhtes Psychoserisiko fand. Stimulanzien erhöhten dieses Risiko sehr leicht weiter (6 %), während die Erhöhung durch Nichtstimulanzien mit 15 % fast dreimal so hoch war wie durch Stimulanzien.74 Eine weitere große Studie anhand des schwedischen Gesundheitsregisters mit 23.898 jugendlichen und jungen Erwachsenen ADHS-Betroffenen verglich das Psychoserisiko vor und nach MPH-Gabe und konnte mit 4 % lediglich eine nicht signifikante Erhöhung der Psychoserisikos durch Methylphenidat feststellen.75 Wenn, scheinen eher hohe MPH-Dosierungen das Psychoserisiko zu erhöhen.76
Die Vorteile einer Behandlung von ADHS (Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit, Verringerung des lebenslangen Depressions- und Angststörungsrisikos, Verringerung des Suchtrisikos etc.) dürften das mögliche Risiko deutlich überwiegen.
Mehr zu den Risiken von (unbehandeltem) ADHS unter ⇒ Folgen von ADHS.
10.5. Anorexierisiko erhöht
Eine Behandlung mit MPH erhöht das Risiko einer Anorexie um das 4,66-fache.77
Bei Betroffenen mit Magersuchttendenzen sollte eine Behandlung mit Stimulanzien daher unterbleiben.
In einer RCT reduzierte MPH das „Hunger-Neuropeptid“ NPY, das Nahrungsaufnahme und Abbau von Angst und Stress steuert, signifikant um 21 %.78
10.6. Krampfschwelle, EEG-Auffälligkeiten
Methylphenidat soll die Krampfschwelle senken können. Dies betreffe Patienten mit bestehender Krampfanfall-Anamnese (z.B. Epileptiker) wie Patienten mit Auffälligkeiten im EEG ohne bisherige Krampfanfälle. Selten soll MPH Krampfanfälle auch ohne die genannten Vorrisiken auslösen können.
Eine Studie mit n = 478 Probanden fand bei 273 (52,8 %) EEG-Auffälligkeiten. Kinder mit und ohne EEG-Auffälligkeiten wiesen ähnliche Muster der MPH-Einnahme auf (Erstkonsum, positive Reaktion und Beibehaltung der MPH-Einnahme). Bei einer Nachprüfung an n = 39 Betroffenen mit EEG-Auffälligkeiten fand sich nach 3 Jahren MPH-Einnahme keine Erhöhung von Krampfanfällen. Nur bei 3 Kindern mit medikamentenresistenter Epilepsie traten Krampfanfälle auf, wobei deren Häufigkeit nicht zugenommen hatte. Bei komorbiden Epilepsie und EEG-Auffälligkeiten war bei MPH-Einnahme das Risiko für Krampfanfälle unverändert.79
Bei einer Zunahme der Anfallshäufigkeit bzw. bei neu auftretenden Krampfanfällen sollte Methylphenidat abgesetzt werden.80
10.7. Anregung bestehender Angststörungen, Depression, Aggression
Komorbide Angststörungen, Depressionen und Aggressionen können durch Stimulanzien verstärkt werden, da Angst und Stimmungen durch die dopaminerge Aktivität des ventromedialen PFC in Verbindung mit dem limbischen System reguliert werden. In diesen Fällen empfehlen sich stattdessen Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer oder α2A-Adrenozeptor-Agonisten.81
Eine (recht kleine) Untersuchung fand keine kurzfristige Veränderung des Angstzustands (state anxiety) durch eine Einzeldosis MPH, jedoch Hinweise auf eine mögliche langfristige Verschlechterung.82
10.8. MPH und Manierisiko bei Bipolarer Störung
Eine Studie fand, dass MPH nicht mit einem erhöhten Risiko einer Manie bei Patienten mit bipolarer Störung verbunden war. Nach der MPH-Behandlung gingen Manien um 50 % zurück. Auch depressive Episoden und psychiatrische Einweisungen verringerten sich.83
10.9. MPH erhöht Histamin
MPH erhöht Histamin,84 ebenso wie alle anderen bekannten ADHS-Medikamente auch:
- Atomoxetin
- Amphetamin
- Modafinil
- Nikotin
- Koffein
Daher haben Menschen mit Histaminintoleranz häufig Probleme durch Einnahme von ADHS-Medikamenten.
Eine ADHS-Betroffene mit Histaminintoleranz berichtete, dass sie AMP und retardiertes MPH gar nicht vertrug, unretardiertes MPH in geringen Dosen jedoch tolerieren konnte.
10.10. Rebound
Als Rebound wird ein kurzzeitiges Ansteigen der eigentlich durch MPH verringerten Symptome am Ende der Wirkzeit von Medikamenten bezeichnet. Wirkt eine MPH-Dosis rund 3 Stunden, so können am Ende der 3 Stunden oder unmittelbar danach für ca. 20 bis 30 Minuten die ADHS-Symptome verstärkt auftreten.
Rebound wird bei unretardiertem MPH häufiger und deutlicher berichtet als bei retardiertem MPH.85
Wir gehen davon aus, dass ein Rebound durch einen zu schnellen Rückgang des Dopamin- / Noradrenalinspiegels hervorgerufen wird. Bei Medikamenten, die einen sehr langsamen Wirkungsrückgang zeigen, scheint ein Rebound seltener aufzutreten.
Ein Rebound kann vermieden werden, indem die Anschlussdosis so rechtzeitig eingenommen wird, dass kein wirkstofffreier Zeitraum verbleibt.
Bei der letzten Tagesdosis soll der Rebound durch eine Einnahme einer sehr viel kleineren Dosis als der üblichen Einzeldosis zu dem Zeitpunkt, an dem sonst die Anschlussdosis genommen würde, abgemildert oder vermieden werden können.
10.11. MPH und Narkose / Anästhesie
Im Falle von Operationen ist neben der aufgrund der teilweise deutlich erhöhten (Medikamenten-)Sensibilität bei ADHS-Betroffenen auch die Frage von Kreuzwirkungen von ADHS-Medikamenten mit Narkosemitteln zu beachten.
Eine Doppelblindstudie aus 1980 fand keine Veränderung der postoperativen Schmerzen durch MPH. Methylphenidat verkürzte bei Halothan-Narkose die postoperative Sedierung um bis zu 30 Minuten und verbesserte die Atmungsfunktion um bis zu 180 Minuten.86 Halothan wird heute nicht mehr verwendet.
Eine Case study berichtet von einem verringerten Ansprechen auf Sedativa und erhöhte Nebenwirkungen durch MPH.87
Eine Studie berichtet eine Korrelation zwischen Aufmerksamkeitsproblemen und postoperativem Delir.88
10.12. Sonstiges zu Nebenwirkungen von MPH
Es wurden Einzelfälle von Trichotillomanie (Haare ausreißen) berichtet.89 Trichotillomanie ist eine spezifische Form einer Impulskontrollstörung.
Eine Studie berichtet von Muskelschmerzen und Steifigkeit als möglicher Nebenwirkung von MPH.90
Eine Studie berichtet eine verdoppelte Rate von Testosteronmangel bei erwachsenen ADHS-Betroffenen nach 5 Jahren Stimulanzieneinnahme (1,2 %) gegenüber ADHS-Betroffenen ohne Stimulanzieneinnahme (0,67 %) oder Nichtbetroffenen (0,68 %).91
10.13. Keine erhöhten kardiovaskulären Risiken
Die Hypothese, dass Methylphenidat erhöhte Herzprobleme verursachen würde, wurde nicht bestätigt.92 Veränderungen der EEG-Werte wurden nicht festgestellt.61 Eine Metastudie fand leicht erhöhte Werte unterhalb statistischer Signifikanz.93
Eine erste Studie mit n = 564 Betroffenen, die eine erhöhte Herztodrate an Kindern, die MPH einnahmen, vermutet hatte, wurde durch eine Vielzahl weiterer Studien, unter anderem durch eine große Studie mit n = 241.417 mit MPH-medikamentierten Kindern, widerlegt.94 Eine sehr große Studie fand für MPH unter 2.566.995 Kindern keinerlei erhöhte Risiken schwerwiegender kardiovaskulärer Vorfälle wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen.95 Auch eine dritte große Registerstudie mit n = 224.732 Personen fand keine erhöhten langfristigen kardiovaskulären Risiken durch MPH. Die Risikoraten waren sogar um 15 % verringert.96
Es gibt zudem Studien, die sogar ein verringertes Herztodrisiko unter MPH bestätigen, was sich durch die ärztliche Betreuung der Betroffenen erklären könnte.
Mehrere Untersuchungen fanden keine signifikante Änderung der Herzfrequenz, des QRS, des QT, des QTc und des QTd-Intervalls in EKGs durch MPH.
Die Tp-Te-Intervalle und die Tp-Te / QTc-Verhältnisse waren nach der Behandlung mit MPH leicht erhöht, aber innerhalb der normalen Werte.97 Kinder mit ADHS zeigten eine signifikant verlängerte P-Wellen-Dispersion, TpTe-Intervall, TpTe-Dispersion sowie TpTe/QT- und TpTe/QTc-Verhältnisse. Darüber hinaus wies fast die Hälfte der Patienten QTc-Werte von 460 ms oder mehr auf. Diese Parameter waren weder mit der MPH-Dosis noch mit der Behandlungsdauer assoziiert.98 QTc-Intervall und fQRS-T-Winkel waren bei medikamentennaiven wie bei medikamentierten ADHS-Betroffenen signifikant höher als bei der gesunden Kontrollgruppe. QTc-Intervall und fQRS-T-Winkel waren jedoch zwischen medikamentennaiven und medikamentierten ADHS-Betroffenen unverändert. Sowohl QTc-Intervall als auch fQRS-T-Winkel korrelierten mit dem Schweregrad der ADHS-Symptome.99
Eine Studie fand für Methylphenidat kein erhöhtes Risiko von Herzrhythmusstörungen. Ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen fand sich dagegen für Atomoxetin für 7 Tage nach der ersten Atomoxetin-Exposition (aIRR 6,22) und bei der nachfolgenden Exposition (aIRR 3,23).100
Eine Studie über 14 Jahre fand eine Erhöhung des Risikos für kardiovaskuläre Probleme um 4 % je Jahr der Einnahme von Stimulanzien (Methylphenidat, Amphetaminmedikamente) sowie, etwas schwächer, beim Nichtstimulanz Atomoxetin.101
Eine Kohortenstudie an n = 252.382 im Altersschnitt von 20 Jahren fand eine posterioren Wahrscheinlichkeit für ein um mindestens 10 % erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse von 70 % bei Personen, die MPH erhielten, gegenüber 49 % bei den angepassten Kontrollen. Es fand sich kein Unterschied des Risikos zwischen Personen mit und ohne kardiovaskuläre Vorgeschichte.102
Eine langfristige Einnahme verursachte keine kardiovaskulären Probleme.103
Bei Erwachsenen sollen kardiovaskuläre Probleme durch MPH möglich sein.104
10.14. Leberschädigungen nicht bekannt
Bei MPH sind keine erhöhten Meldungen über Leberschäden bekannt.105 Leberwerte sollten bei der Einstellung von ADHS-Medikamenten dennoch grundsätzlich überwacht werden.
10.15. Keine negativen Langzeitwirkungen von MPH
Die uns bisher bekannten Berichte über schädigende Wirkung einer Langzeiteinnahme von MPH basieren durchgängig auf einer massiven Überdosierung. Derartige Untersuchungen sind üblich und sinnvoll, um die Grenzen der Verträglichkeit eines Wirkstoffs auszuloten. Sie besagen jedoch nichts über Gefahren bei einer langfristigen Einnahme in medikamentenüblichen Dosen.
Zur Relation: Menschen benötigen 30 bis 40 ml Wasser je kg und Tag (2 bis 3 Liter). 3 Liter Wasser auf einmal oder 5 Liter Wasser am Tag können jedoch bereits tödlich wirken. Demnach kann schon eine Verdoppelung der Gabe von Wasser beim Menschen tödliche Wirkungen haben.
Eine großangelegte Langzeitstudie zu MPH über 2 Jahre an Kindern mit ADHS fand in der MPH-Gruppe:106
- keine signifikante Beeinträchtigung des Wachstums
- leichte Gewichtsabnahme in den ersten 6 Monaten, die sich danach gab
- keine Veränderung in Bezug auf Psychosen, Depressionen, Dyskinesien, Tics
- geringfügig erhöhter Blutdruck und Puls
- präventive Wirkung in Bezug auf Sucht und Suizid
- signifikant erhöhter Nikotin- und Marihuanakonsum in der Nicht-MPH-Gruppe
- signifikant erhöhte Suizidalität in der Nicht-MPH-Gruppe
Eine bevölkerungsbasierte Kohortenstudie mit Daten aus dänischen Registern an Patienten, die zwischen 1995 und 2018 kontinuierlich über einen längeren Zeitraum (d. h. ≥ 12 Monate) entweder Medikinet® MR oder Concerta® eingenommen hatten, fand:107
- keine Fälle von zerebraler Arteriitis
- keine Fälle von Priapismus
- keinen Fall von plötzlichem Tod unter Medikinet® MR
- keine statistisch signifikanten Risiko-Unterschiede zwischen Medikinet® MR und Concerta®
Eine Studie an Primaten fand 6 Monate nach Beendigung einer 12 Jahre andauernden Langzeitgabe von MPH keine Veränderung von Gehirnparametern.108
Bei einer langfristigen Gabe des 15- bis 20-fachen der als Medikament üblichen Tagesdosis fand eine Studie bei erwachsenen Ratten Schäden an Morphologie und Funktion des Cerebellums.109 Dies ist bei derartiger Dosierung erwartungsgemäß.
Eine Studie an Ratten, die in der Pubertät mit 5 mg/kg/Tag das Fünffache der bei Menschen üblichen maximalen Tagesdosis erhielten, fand bei den erwachsenen Tieren eine Beeinträchtigung der Spermaqualität.110 Es handelte sich zudem um Wistar-Ratten, also Ratten, die keinen Dopaminmangel aufweisen.
Eine Studie an Balb/c-Mäusen (einem Tiermodell für ASS), die ebenfalls kein Dopamindefizit, sondern eher einen Dopaminüberschuss zeigen111, fand eine Beeinträchtigung der Spermaqualität durch MPH. Diese Studie spekulierte zudem über eine Toxizität von MPH aufgrund eines Gewichtsverlustes der Tiere auf 20 mg/kg und 40 mg/kg MPH, was einer Drogendosis gleicht.112 Dass Stimulanzien den Appetit verringern, ist bekannt. Dass dopaminerhöhende Wirkstoffe bei Lebewesen, die keinen verringerten Dopaminspiegel aufweisen, nachteilig ist, ist nicht verwunderlich, sondern zu erwarten.
Bei Hyperaktivitäts-Betroffenen fand sich nach Methylphenidat-Einnahme kein statistisch signifikanter Unterschied der Spermienzahl, jedoch ein signifikanter Unterschied in Bezug auf die Spermienmotilität und -anomalie.113
In einer Studie erhielten Affen zweimal täglich 2,5 mg/kg oder 12,5 mg /kg MPH. 12,5 mg / kg zweimal täglich ist rund das 25-fache der üblicherweise empfohlenen Maximaldosierung für Menschen und stellt aus unserer Sicht eher eine Drogendosis als eine Medikamentendosis dar.
Bis auf eine vorübergehende Verringerung der Motivation nach dem Ende der MPH-Gabe (auch diese nur bei der “Drogendosis”) fanden sich keine negativen Auswirkungen.114
Bei zweimal 12,5 mg/kg / Tag zeigte sich zudem, wie bei derartiger Überdosierung zu erwarten, eine deutliche Verschlechterung der kognitiven Leistung.115
10.16. Verringertes Risiko von Stressfrakturen
Die MPH-Einnahme durch ADHS-Betroffene verringerte das Risiko von Stressfrakturen gegenüber Nichtbetroffenen (ohne MPH-Einnahme).116
10.17. Verringertes Risiko von Typ 2 Diabetes
Methylphenidat verringerte das Risiko in den ersten 3 Einnahmejahren für Typ 2- Diabetes um 20 %.117 Eine Langzeiteinnahme von Atomoxetin über mehr als 3 Jahre erhöhte das Risiko um 44 %. Lisdexamfetamin hatte keinen Einfluss.
11. Wechselwirkungen und Kontraindikationen
Wie bei jedem Medikament gibt es auch bei MPH Kontraindikationen.
Eine Einnahme ohne vorherige ärztliche Konsultation ist riskant!
Methylphenidat wird unabhängig vom Cytochrom-P450-System metabolisiert, sodass nur nur ein sehr geringes Potenzial für pharmakokinetische Interaktionen besteht.80
11.1. Wechselwirkungen von Methylphenidat mit anderen Medikamenten
11.1.1. Verstärkte Wirkung anderer Medikamente / Stoffe durch MPH
-
Koffein kann intensiver wirken
Koffein sollte insbesondere bei der Eindosierung von Stimulanzien (z.B. MPH) strikt gemieden werden. Häufig bewirken Stimulanzien, dass Koffein in Dosen, die bislang problemlos vertragen wurden, nun eine innere Zitterigkeit auslöst. Dies kann fälschlich als (Neben-)Wirkung der Stimulanzien interpretiert werden.
Eine sehr hohe Koffeindosis (zigfach über Medikamentenniveau) über mehrere Tage verringerte bei Ratten die Wirksamkeit von MPH, und umgekehrt. Dies bestätigt, dass MPH und Koffein gemeinsame,118119 aber nicht identische120 Wirkmechanismen haben. -
Alkohol
Eine umfangreiche Metaanalyse fand wenig Anhaltspunkte, dass ADHS-Medikamente in Kombination mit Alkohol oder anderen Drogen besondere negative Effekte verzeichnen würden.121- Zusammen mit MPH eingenommen kann Alkohol intensiver wirken
- Zusammen mit MPH eingenommener Alkohol kann den MPH-Spiegel erhöhen122
-
alle Sympathomimetika123 können durch MPH verstärkt werden.
Betroffene Wirkstoffe:- α-Sympathomimetika123
- β-Sympathomimetika123
- Fenoterol
- Orciprenalin
- Katecholamin-Derivate
-
Monoaminoxidasehemmer (MAOI)
-
blutdrucksteigernde Mittel80
-
Halogenierte Narkosegase
- können bei Patienten unter Methylphenidat Blutdruckspitzen auslösen80 Bei geplanten chirurgischen Eingriffen sollte Methylphenidat am Operationstag nicht angewendet werden.
-
Alle zentral dopaminergen und noradrenergen Wirkstoffe80
Hier sollte eine engmaschige Kontrolle des Blutdrucks erfolgen.
Beispiele:- Moclobemid
- Linezolid
- Selegilin
- Rasagilin
- Levodopa
- sonstige Parkinsonmittel
- zentral wirkende α2-Agonisten, z.B.
- Clonidin
- Methyldopa
11.1.2. Hemmung der Verstoffwechselung anderer Medikamente durch MPH
- Antikonvulsiva128
- Phenobarbital123129
- Phenytoin123129
- Primidon123
- Carbamazepin
- 2 Einzelfallberichte deuten an, dass mindestens eine Verdopplung der MPH-Dosis erforderlich sein könnte, wenn zugleich Carbamazepin hochdosiert gegeben wird129
- Rifampin möglicherweise129
MPH verringert die Wirkung von Antikonvulsiva123
Antikonvulsiva verringern nach einigen Wochen den MPH-Blutspiegel129
- trizyklische Antidepressiva80, z.B.:
- Amitriptylin123
- Imipramin123
Methylphenidat verstärkt die Wirkung von Imipramin,129 während Imipramin zugleich die Wirkung von MPH verstärkt. Daher ist eine besonders vorsichtige Dosierung von Imipramin bei gleichzeitiger MPH-Gabe empfehlenswert.
Symptome sind:- Verwirrtheit und Agitiertheit
- Stimmungslabilität
- Gereiztheit und Aggressivität
- Psychotische Symptome
- Phenylbutazon (Butazolidin)123
Phenylbutazon ist ein heute nur noch selten verwendetes nichtsteroidales Antirheumatikum. - Antikoagulantien (Blutgerinnungshemmer)123
- orale Antikoagulanzien vom Cumarin-Typ, z.B. Phenprocoumon, Warfarin
Hier sind Wirkungsschwankungen durch Interaktion mit Methylphenidat möglich. Mechanismus ist unbekannt. Beim An- und Absetzen von Methylphenidat empfiehlt sich daher eine engmaschige Überwachung der Gerinnungsparameter.80
- orale Antikoagulanzien vom Cumarin-Typ, z.B. Phenprocoumon, Warfarin
- Antihypertensiva80, z.B.:
- ACE-Hemmer
- Angiotensin-Rezeptor-Blocker
- Diuretika
- Kalziumkanalblocker
- Beta-Blocker
- Metoclopramid (Prokinetikum, Dopaminantagonist)80
11.1.3. Veränderungen der Wirkung von MPH durch andere Medikamente
Ein erhöhter Magen-pH-Wert ab 5,5 kann bei Medikinet adult die Wirkstofffreisetzung der retardierten Anteile beschleunigen / erhöhen. Die Freisetzung von Methylphenidat aus Ritalin adult erfolgt hingegen pH-unabhängig. Bei Ritalin adult ist gleichwohl eine Resorptionsverminderung durch Antazida möglich.80
Der Magen-pH-Wert kann erhöht werden durch:
- Protonenpumpenhemmer, z.B.
- Pantoprazol
- Omeprazol
- H2-Antagonisten (wenn auch weniger wahrscheinlich), z.B.
- Ranitidin
- Famotidin
- Antazida
Chronisches orales MPH allein erzeugte bei Ratten im Striatum eine Tendenz zu130
- erhöhter Dynorphin-Expression
- erhöhter Substanz P-Expression
- unveränderter Enkephalin-Expression.
Orales Fluoxetin allein veränderte die Expression dieser Gene nicht.
MPH und Fluoxetin gemeinsam bewirkten
- stark erhöhte Dynorphin-Expression
- stark erhöhte Substanz P-Expression
- erhöhte Enkephalin-Expression
Oxytocin potenziert die durch MPH induzierten Stimulation der tonischen (extrazellulären) Dopaminfeuerung, wahrscheinlich durch Modulation der Dopamin-Rezeptor-Signalpfade. Oxytocin beeinflusste weder die durch MPH bewirkte Dopaminwiederaufnahme, noch das durch MPH bewirkte phasische Dopaminfeuern.131
CBD (Cannabidiol) beeinflusste MPH-Spiegel und -AUC nur unwesentlich, obwohl CBD ein CES1-Inhibitor ist.132
11.1.4. Keine Wechselwirkungen von MPH + SSRI
Eine Studie an n = 17.234 Erwachsenen fand keine Nachteile einer gemeinsamen Einnahme von MPH und SSRI. Eine Einnahme von SSRI zu MPH verringerte das Kopfschmerzrisiko.{{Lee DY, Kim C, Shin Y, Park RW (2024): Combined Methylphenidate and Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. JAMA Netw Open. 2024 Oct 1;7(10):e2438398. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.38398. PMID: 39382893; PMCID: PMC11581539.}
11.2. MPH und Blutdruck
Methylphenidat kann den Blutdruck bei Kindern erhöhen.
Bei Kindern mit ADHS scheinen die Blutplasmawerte von Stickoxid erhöht und von asymmetrischem Dimethylarginin (ADMA) verringert. ADMA hemmt die blutdruckerhöhende Wirkung von Stickoxid. Bei MPH-Einnahme erhöhten sich die Stickoxid-Plasmawerte weiter. Dies könnte möglicherweise an einer verringerten Hemmung von Stickoxid durch ADMA bei MPH-Gabe liegen und eine Ursache der blutdruckerhöhenden Wirkung von MPH darstellen.104
Eine umfassende Studie konnte dagegen keine Beeinträchtigung des Blutdrucks bei Jungen mit ADHS durch MPH feststellen.57
Bei Bluthochdruckrisikopatienten ist daher abzuwägen, inwieweit das mögliche Risiko einer medikamentenbedingten Blutdruckerhöhung den möglichen Vorteil eines verringerten Blutdrucks aufgrund der verringerten Stressempfindlichkeit überwiegt.
Ein höherer Blutdruckanstieg bei der ersten Methylphenidateinnahme deutete auf eine größere ADHS-Symptomverringerung nach 6 Monaten hin.26
11.3. MPH-Einnahme in der Schwangerschaft
Studien zur Einnahme von MPH während der Schwangerschaft fanden in Bezug auf den Nachwuchs
- Gewicht
- Risiken von Präeklampsie, Plazentaunterbrechung oder Frühgeburt bei Stimulanzieneinnahme (AMP oder MPH) in der Schwangerschaft, die allerdings so gering war, dass die Autoren keine Absetzung der Stimulanzieneinnahme in der Schwangerschaft empfahlen.135 Atomoxetin zeigte diese leichten Risikoerhöhungen nicht.
- Fehlgeburtsrisiko durch Stimulanzien während der Schwangerschaft
- Missbildungen
- sehr geringe Zunahme (nicht relevant)138
- kein erhöhtes Risiko.139
- geringfügig erhöht (Metastudie, k = 4) in Bezug auf Missbildungen und Herzmissbildungen bei MPH-Einnahme in der frühen Schwangerschaft140
- durch Methylphenidat und Atomoxetin nicht statistisch signifikant erhöht (+ 14 %) (Metastudie, k = 10, n = 16.621.481)136
- ADHS-Symptome
- erhöht in Studie an Mäusen
- verringerte Expressionen der D2-Rezeptor- und der Dopamintransportergene, wie sie bei ADHS häufig sind, bei 2,5- bis 15-fache Dosierung im Vergleich zum üblichen maximalen Medikamentenniveau141 Dies deckt sich plausibel mit dem Modell von Gehirnentwicklungsstörungen, die durch einen Mangel an Dopamin (z.B. genetisch ererbt oder aufgrund chronischen Stresses) oder einen Überschuss an Dopamin (z.B. durch Stimulanziengabe bei Nichtbetroffenen) verursacht werden. Mehr hierzu unter ⇒ Gehirnentwicklungsstörung und ADHS im Kapitel ⇒ Entstehung.
- kein erhöhtes Risiko für ADHS oder andere neuronale Entwicklungsstörungen durch MPH- oder AMP-Einnahme in der Schwangerschaft. Das zunächst gefundene erhöhte ADHS-Risiko war bei genauerer Betrachtung auf das ADHS der Mütter zurückzuführen.142
- neurologische Entwicklungsstörungen
- Risiko unverändert (schwedische Kohortenstudie, n = 861,650 Kinder von n = 572,731 Müttern von 2008-2017)143
11.4. Mögliche Kontraindikationen
Vorsicht ist geboten bei der Verwendung von Methylphenidat bei:80
- Glaukom
- Hyperthyreose
- Thyreotoxikose
- schwerer Depression
- Psychosen, z.B.
- Schizophrenie
- Manie
- bipolare Störung Typ I
- Kardiomyopathien
- insbesondere schwere Arrhythmien
- Asthma144
- Interstitielle Pneumonie oder Fibrose144
Barkley, DuPaul, McMurray (1991): Attention deficit disorder with and without hyperactivity: Clinical response to three dose levels of methylphenidate. Pediatrics, 87, 519–531 ↥
Diamond: Attention-deficit disorder (attention-deficit/hyperactivity disorder without hyperactivity): A neurobiologically and behaviorally distinct disorder from attention-deficit (with hyperactivity), Development and Psychopathology 17 (2005), 807–825, Seite 811 ↥
Peters, Frühgeborene und Schule – Ermutigt oder ausgebremst? Kapitel 2: Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (AD(H)S), Seite 132 ↥
Childress, Komolova, Sallee (2019): An update on the pharmacokinetic considerations in the treatment of ADHD with long-acting methylphenidate and amphetamine formulations. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2019 Nov;15(11):937-974. doi: 10.1080/17425255.2019.1675636. PMID: 31581854. ↥ ↥
Ching, Eslick, Poulton (2019): Evaluation of Methylphenidate Safety and Maximum-Dose Titration Rationale in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2019 May 28. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.0905. ↥ ↥ ↥
Elbe, Black, McGrane, Procyshyn (Hrsg.) (2019): Clinical Handbook of Psychotrophic Drugs for Children and Adolescents, 4th edition ↥ ↥ ↥ ↥
Buitelaar JK, Ramos-Quiroga JA, Casas M, Kooij JJ, Niemelä A, Konofal E, Dejonckheere J, Challis BH, Medori R (2009): Safety and tolerability of flexible dosages of prolonged-release OROS methylphenidate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2009;5:457-66. doi: 10.2147/ndt.s6873. PMID: 19777067; PMCID: PMC2747385. ↥
Wigal SB, Nordbrock E, Adjei AL, Childress A, Kupper RJ, Greenhill L (2015): Efficacy of Methylphenidate Hydrochloride Extended-Release Capsules (Aptensio XR™) in Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Phase III, Randomized, Double-Blind Study. CNS Drugs. 2015 Apr;29(4):331-40. doi: 10.1007/s40263-015-0241-3. PMID: 25877989; PMCID: PMC4425805. RCT ↥
Huss M, Ginsberg Y, Tvedten T, Arngrim T, Philipsen A, Carter K, Chen CW, Kumar V (2014): Methylphenidate hydrochloride modified-release in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Adv Ther. 2014 Jan;31(1):44-65. doi: 10.1007/s12325-013-0085-5. PMID: 24371021; PMCID: PMC3905180. RCT ↥
Huss M, Ginsberg Y, Arngrim T, Philipsen A, Carter K, Chen CW, Gandhi P, Kumar V (2014): Open-label dose optimization of methylphenidate modified release long acting (MPH-LA): a post hoc analysis of real-life titration from a 40-week randomized trial. Clin Drug Investig. 2014 Sep;34(9):639-49. doi: 10.1007/s40261-014-0213-2. PMID: 25015027; PMCID: PMC4143596. RCT ↥
Chermá MD, Josefsson M, Rydberg I, Woxler P, Trygg T, Hollertz O, Gustafsson PA (2017): Methylphenidate for Treating ADHD: A Naturalistic Clinical Study of Methylphenidate Blood Concentrations in Children and Adults With Optimized Dosage. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2017 Apr;42(2):295-307. doi: 10.1007/s13318-016-0346-1. PMID: 27220743; PMCID: PMC5340830. ↥
Bonvicini, Faraone, Scassellati (2016): Attention-deficit hyperactivity disorder in adults: A systematic review and meta-analysis of genetic, pharmacogenetic and biochemical studies. Mol Psychiatry. 2016 Jul;21(7):872-84. doi: 10.1038/mp.2016.74. Erratum in: Mol Psychiatry. 2016 Nov;21(11):1643. PMID: 27217152; PMCID: PMC5414093. REVIEW ↥
Huss M, Duhan P, Gandhi P, Chen CW, Spannhuth C, Kumar V (2017): Methylphenidate dose optimization for ADHD treatment: review of safety, efficacy, and clinical necessity. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017 Jul 4;13:1741-1751. doi: 10.2147/NDT.S130444. PMID: 28740389; PMCID: PMC5505611. REVIEW ↥ ↥ ↥
http://www.ads-hyperaktivitaet.de/FAQ/Infos/Medis/medis.html#1 ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Krause, Krause (2014): ADHS im Erwachsenenalter: Symptome – Differenzialdiagnose – Therapie, Seite 254, mwN ↥ ↥ ↥ ↥
ähnlich argumentierend, aber schneller eindosierend: Dreher (2019): ADHS im Erwachsenenalter. Anleitung zur Diagnostik und erste Therapieschritte, Seite 31. Download 06.01.2020 ↥
Tan, King (2022): Finding the “Sweet Spot”: Sharing the decision-making in ADHD treatment selection. Ann Gen Psychiatry. 2022 May 27;21(1):14. doi: 10.1186/s12991-022-00394-2. PMID: 35624455; PMCID: PMC9145110. ↥
Farhat LC, Flores JM, Behling E, Avila-Quintero VJ, Lombroso A, Cortese S, Polanczyk GV, Bloch MH (2022): The effects of stimulant dose and dosing strategy on treatment outcomes in attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis. Mol Psychiatry. 2022 Mar;27(3):1562-1572. doi: 10.1038/s41380-021-01391-9. PMID: 35027679. METASTUDIE ↥
praxis-suchtmedizin.ch: Dosierungs- und Aequivalenz-Tabelle Methylphenidat Präparate – Schweiz – ↥
Dorfplatzapotheke, CH-3110 Münsingen. Eine Flasche mit 50 Gramm kostet SFR 50,50. ↥
Krause, Krause (2014): ADHS im Erwachsenenalter: Symptome – Differenzialdiagnose – Therapie, S. 267 mwNw ↥
Nemoda, Angyal, Tarnok, Gadoros, Sasvari-Szekely (2009): Carboxylesterase 1 gene polymorphism and methylphenidate response in ADHD. Neuropharmacology. 2009 Dec;57(7-8):731-3. doi: 10.1016/j.neuropharm.2009.08.014. PMID: 19733552. ↥
Solleveld, Schrantee, Baek, Bottelier, Tamminga, Bouziane Stoffelsen, Lucassen, Van Someren, Rijsman, Reneman (2020): Effects of 16 Weeks of Methylphenidate Treatment on Actigraph-Assessed Sleep Measures in Medication-Naive Children With ADHD. Front Psychiatry. 2020 Feb 28;11:82. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00082. PMID: 32184743; PMCID: PMC7058799. ↥ ↥
Corkum, Begum, Rusak, Rajda, Shea, MacPherson, Williams, Spurr, Davidson (2020): The Effects of Extended-Release Stimulant Medication on Sleep in Children with ADHD. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020 Mar;29(1):33-43. PMID: 32194650; PMCID: PMC7065567. n = 26 ↥ ↥
D’Aiello B, Menghini D, Cordaro G, Vicari S, De Rossi P (2025): Change in vital parameters at first methylphenidate administration as a predictor of treatment response at six-month follow-up. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2025 Aug 29. doi: 10.1007/s00787-025-02845-z. PMID: 40879766. ↥ ↥
Martinez, Pasquereau, Drui, Saga, Météreau, Tremblay (2020): Ventral striatum supports Methylphenidate therapeutic effects on impulsive choices expressed in temporal discounting task. Sci Rep. 2020 Jan 20;10(1):716. doi: 10.1038/s41598-020-57595-6. PMID: 31959838. ↥
Mohammadgholi-Beiki A, Aghamiri H, Rashidian R, Jafari-Sabet M, Motevalian M, Rahimi-Moghaddam P, Sheibani M (2025): Investigation of the Protective Effects of Aripiprazole on Methylphenidate-induced Neurotoxicity in Rats. Mol Neurobiol. 2025 Sep;62(9):11581-11595. doi: 10.1007/s12035-025-04994-3. PMID: 40299297. ↥
Jaeschke, Sujkowska, Sowa-Kućma (2021): Methylphenidate for attention-deficit/hyperactivity disorder in adults: a narrative review. Psychopharmacology (Berl). 2021 Oct;238(10):2667-2691. doi: 10.1007/s00213-021-05946-0. PMID: 34436651; PMCID: PMC8455398. REVIEW ↥
Krause, Krause (2014): ADHS im Erwachsenenalter: Symptome – Differenzialdiagnose – Therapie, Seite 267 ↥
Li Y, van Kralingen T, Masi M, Villanueva Sanchez B, Mitchell B, Johnson J, Miranda-Barrientos J, Rehg J, Martinowich K, Carr GV (2025): Time-on-task-related decrements in performance in the rodent continuous performance test are not caused by physical disengagement from the task. NPP Digit Psychiatry Neurosci. 2025;3(1):4. doi: 10.1038/s44277-025-00025-0. PMID: 39959604; PMCID: PMC11825365. ↥
Anderson, McFadden, Matuszewich (2019): Interaction of stress and stimulants in female rats: Role of chronic stress on later reactivity to methamphetamine. Behav Brain Res. 2019 Dec 30;376:112176. doi: 10.1016/j.bbr.2019.112176. ↥
Coelho-Santos V, Cardoso FL, Leitão RA, Fontes-Ribeiro CA, Silva AP (2018): Impact of developmental exposure to methylphenidate on rat brain’s immune privilege and behavior: Control versus ADHD model. Brain Behav Immun. 2018 Feb;68:169-182. doi: 10.1016/j.bbi.2017.10.016. PMID: 29061363. ↥
Rösler, Retz (2020): Medikamentöse Therapie der ADHS bei Erwachsenen; Psychiatrie up2date 2020; 14: 59–75 ↥
Manor I, Rozen S, Zemishlani Z, Weizman A, Zalsman G (2011): When does it end? Attention-deficit/hyperactivity disorder in the middle aged and older populations. Clin Neuropharmacol. 2011 Jul-Aug;34(4):148-54. doi: 10.1097/WNF.0b013e3182206dc1. PMID: 21738027. ↥
Smith KR, Kahlon CH, Brown JN, Britt RB (2021): Methylphenidate use in geriatric depression: A systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2021 Sep;36(9):1304-1312. doi: 10.1002/gps.5536. PMID: 33829530. ↥
Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; Steering Committee on Quality Improvement and Management; Wolraich M, Brown L, Brown RT, DuPaul G, Earls M, Feldman HM, Ganiats TG, Kaplanek B, Meyer B, Perrin J, Pierce K, Reiff M, Stein MT, Visser S (2011): ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics. 2011 Nov;128(5):1007-22. doi: 10.1542/peds.2011-2654. PMID: 22003063; PMCID: PMC4500647. ↥
Wolraich ML, Hagan JF Jr, Allan C, Chan E, Davison D, Earls M, Evans SW, Flinn SK, Froehlich T, Frost J, Holbrook JR, Lehmann CU, Lessin HR, Okechukwu K, Pierce KL, Winner JD, Zurhellen W (2019): SUBCOMMITTEE ON CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVE DISORDER. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. Pediatrics. 2019 Oct;144(4):e20192528. doi: 10.1542/peds.2019-2528. Erratum in: Pediatrics. 2020 Mar;145(3): PMID: 31570648; PMCID: PMC7067282. ↥
Canadian ADHD Practice Guidelines, (CAP-Guidelines), Third Edition ↥
May T, Birch E, Chaves K, Cranswick N, Culnane E, Delaney J, Derrick M, Eapen V, Edlington C, Efron D, Ewais T, Garner I, Gathercole M, Jagadheesan K, Jobson L, Kramer J, Mack M, Misso M, Murrup-Stewart C, Savage E, Sciberras E, Singh B, Testa R, Vale L, Weirman A, Petch E, Williams K, Bellgrove M (2023): The Australian evidence-based clinical practice guideline for attention deficit hyperactivity disorder. Aust N Z J Psychiatry. 2023 Aug;57(8):1101-1116. doi: 10.1177/00048674231166329. PMID: 37254562; PMCID: PMC10363932. REVIEW ↥
Malaysian Health Technology Assessment Section (MaHTAS) (2020): Clinical Practice Guidelines (CPGs): Management of Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) in Children and Adolescent (2nd Edition) ↥
Taylor E, Döpfner M, Sergeant J, Asherson P, Banaschewski T, Buitelaar J, Coghill D, Danckaerts M, Rothenberger A, Sonuga-Barke E, Steinhausen HC, Zuddas A (2004): European clinical guidelines for hyperkinetic disorder – first upgrade. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2004;13 Suppl 1:I7-30. doi: 10.1007/s00787-004-1002-x. PMID: 15322953. ↥
Langfassung der interdisziplinären evidenz- und konsensbasierten (S3) Leitlinie„Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend und Erwachsenenalter“AWMF-Registernummer 028-045 S. 75 ↥
Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte e.V., Stand 2009, ADHS bei Kindern und Jugendlichen, Seite 10 ↥
Nutt DJ, Fone K, Asherson P, Bramble D, Hill P, Matthews K, Morris KA, Santosh P, Sonuga-Barke E, Taylor E, Weiss M, Young S; British Association for Psychopharmacology (2007): Evidence-based guidelines for management of attention-deficit/hyperactivity disorder in adolescents in transition to adult services and in adults: recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2007 Jan;21(1):10-41. doi: 10.1177/0269881106073219. PMID: 17092962. ↥
Bolea-Alamañac B, Nutt DJ, Adamou M, Asherson P, Bazire S, Coghill D, Heal D, Müller U, Nash J, Santosh P, Sayal K, Sonuga-Barke E, Young SJ (2014): British Association for Psychopharmacology. Evidence-based guidelines for the pharmacological management of attention deficit hyperactivity disorder: update on recommendations from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2014 Mar;28(3):179-203. doi: 10.1177/0269881113519509. PMID: 24526134. ↥
Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management, NICE guideline [NG87] ↥
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2009). In: Management of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders in Children and Young People – A National Clinical Guideline. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) ↥
Development Group of the Clinical Practice Guideline on Attention Defi cit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Childrenand Adolescents. Fundació Sant Joan de Déu, coordinator. Clinical Practice Guideline on Attention Defi cit HyperactivityDisorder (ADHD) in Children and Adolescents.Quality Plan for the National Health System of the Ministry of Health, SocialPolicies and Equality. Agència dinformació, Avaluació i Qualitat (AIAQS) of Catalonia; 2010. Clinical Practice Guidelinesin the Spanish NHS (SNS): AATRM No 2007/18. ↥
Coelho-Santos V, Cardoso FL, Magalhães A, Ferreira-Teixeira M, Leitão RA, Gomes C, Rito M, Barbosa M, Fontes-Ribeiro CA, Silva AP (2019): Effect of chronic methylphenidate treatment on hippocampal neurovascular unit and memory performance in late adolescent rats. Eur Neuropsychopharmacol. 2019 Dec;29(2):195-210. doi: 10.1016/j.euroneuro.2018.12.007. PMID: 30554860. ↥
Storebø OJ, Krogh HB, Ramstad E, Moreira-Maia CR, Holmskov M, Skoog M, Nilausen TD, Magnusson FL, Zwi M, Gillies D, Rosendal S, Groth C, Rasmussen KB, Gauci D, Kirubakaran R, Forsbøl B, Simonsen E, Gluud C (2015): Methylphenidate for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: Cochrane systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses of randomised clinical trials. BMJ. 2015 Nov 25;351:h5203. doi: 10.1136/bmj.h5203. PMID: 26608309; PMCID: PMC4659414. COCHRANE METASTUDY ↥ ↥
Nanda A, Janga LSN, Sambe HG, Yasir M, Man RK, Gogikar A, Mohammed L (2023): Adverse Effects of Stimulant Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Comprehensive Systematic Review. Cureus. 2023 Sep 26;15(9):e45995. doi: 10.7759/cureus.45995. PMID: 37900465; PMCID: PMC10601982. ↥
Tunca Ç, Güllü İH, Demirtaş İnci S, Kalkan K, Demirkol Tunca R, Efe A, Özkaya Ibiş AN, Taş A, Taha Özkan M, Tanik VO, Ortaköylü O, Özbeyaz NB (2025): Echocardiographic Evaluation of the Effect of Long-Term Methylphenidate Use on Cardiovascular Functions. J Atten Disord. 2025 Mar;29(5):326-335. doi: 10.1177/10870547241307680. PMID: 39754497. ↥
McCarthy, Neubert, Man, Banaschewski, Buitelaar, Carucci, Coghill, Danckaerts, Falissard, Garas, Häge, Hollis, Inglis, Kovshoff, Liddle, Mechler, Nagy, Rosenthal, Schlack, Sonuga-Barke, Zuddas, Wong (2018): Effects of long-term methylphenidate use on growth and blood pressure: results of the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS). BMC Psychiatry. 2018 Oct 11;18(1):327. doi: 10.1186/s12888-018-1884-7. n = 4244 ↥ ↥
Koonrungsesomboon, Koonrungsesomboon (2019): The Effects of Methylphenidate Treatment on Child Growth in Thai Children and Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2019 Dec 16. doi: 10.1089/cap.2019.0115. n = 911 ↥ ↥
McCarthy, Neubert, Man, Banaschewski, Buitelaar, Carucci, Coghill, Danckaerts, Falissard, Garas, Häge, Hollis, Inglis, Kovshoff, Liddle, Mechler, Nagy, Rosenthal, Schlack, Sonuga-Barke, Zuddas, Wong (2018): Effects of long-term methylphenidate use on growth and blood pressure: results of the German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS). BMC Psychiatry. 2018 Oct 11;18(1):327. doi: 10.1186/s12888-018-1884-7. n = 4.244 ↥ ↥
Waltereit, Müller (2018): Weiterbildungs-Curriculum Psychopharmakologie/Pharmakotherapie, Teil 4: Psychopharmakologie und klinische Psychopharmakotherapie der Stimulanzien, Psychopharmakotherapie 2018;25: 199–207. german ↥
Işik, Kaygisiz (2020): Assessment of intraocular pressure, macular thickness, retinal nerve fiber layer, and ganglion cell layer thicknesses: ocular parameters and optical coherence tomography findings in attention-deficit/hyperactivity disorder. Braz J Psychiatry. 2020 Jan 31:S1516-44462020005002203. doi: 10.1590/1516-4446-2019-0606. PMID: 32022160. n = 147 ↥
Froehlich, Brinkman, Peugh, Piedra, Vitucci, Epstein (2019): Pre-Existing Comorbid Emotional Symptoms Moderate Short-Term Methylphenidate Adverse Effects in a Randomized Trial of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2019 Dec 16. doi: 10.1089/cap.2019.0125. n = 171 ↥
Ogrim, Hestad, Brunner, Kropotov (2013): Predicting acute side effects of stimulant medication in pediatric attention deficit/hyperactivity disorder: data from quantitative electroencephalography, event-related potentials, and a continuous-performance test. Neuropsychiatr Dis Treat. 2013;9:1301-9. doi: 10.2147/NDT.S49611. n = 70 ↥ ↥ ↥
Joensen B, Meyer M, Aagaard L (2017): Specific Genes Associated with Adverse Events of Methylphenidate Use in the Pediatric Population: A Systematic Literature Review. J Res Pharm Pract. 2017 Apr-Jun;6(2):65-72. doi: 10.4103/jrpp.JRPP_16_161. PMID: 28616427; PMCID: PMC5463551. REVIEW ↥
Trott, Wirth (2000): die Pharmakotherapie der hyperkinetischen Störungen; in: Steinhausen (Herausgeber) hyperkinetischen Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 2. Aufl., Seite 213, mit weiteren Nachweisen ↥
Ghajar, DeBoer (2020): Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Are at Increased Risk for Slowed Growth and Short Stature in Early Childhood. Clin Pediatr (Phila). 2020 Feb 1:9922820902437. doi: 10.1177/0009922820902437. PMID: 32009447. n = 7.603 ↥
Curtin, Fleckenstein, Keeshin, Yurgelun-Todd, Renshaw, Smith, Hanson (2018): Increased risk of diseases of the basal ganglia and cerebellum in patients with a history of attention-deficit/hyperactivity disorder; Neuropsychopharmacologyvolume 43, pages2548–2555, 2018 ↥
Oakes, Ketchem, Hall, Ensley, Archibald, Pond (2019): Chronic methylphenidate induces increased quinone production and subsequent depletion of the antioxidant glutathione in the striatum. Pharmacol Rep. 2019 Aug 16;71(6):1289-1292. doi: 10.1016/j.pharep.2019.08.003. ↥
Sadasivan, Pond, Pani, Qu, Jiao, Smeyne (2012): Methylphenidate exposure induces dopamine neuron loss and activation of microglia in the basal ganglia of mice. PLoS One. 2012;7(3):e33693. doi: 10.1371/journal.pone.0033693. ↥
Herhaus (2014): Besteht ein Zusammenhang zwischen Symptomen der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung in der Kindheit sowie ihrer Pharmakotherapie und dem späteren Auftreten eines Parkinson-Syndroms? Dissertation. n = 144 ↥
Kindt HM, Tuan WJ, Bone CW (2923): Do prescription stimulants increase risk of Parkinson’s disease among adults with attention-deficit hyperactivity disorder? A retrospective cohort study. Fam Pract. 2023 Jan 3:cmac153. doi: 10.1093/fampra/cmac153. PMID: 36593727. n = 59.471 ↥
Moran, Ongur, Hsu, Castro, Perlis, Schneeweiss (2019): Psychosis with Methylphenidate or Amphetamine in Patients with ADHD. N Engl J Med. 2019 Mar 21;380(12):1128-1138. doi: 10.1056/NEJMoa1813751. n = 221.846 ↥
Hamard J, Rousseau V, Durrieu G, Garcia P, Yrondi A, Sommet A, Revet A, Montastruc F (2024): Psychosis with use of amphetamine drugs, methylphenidate and atomoxetine in adolescent and adults. BMJ Ment Health. 2024 Apr 12;27(1):e300876. doi: 10.1136/bmjment-2023-300876. PMID: 38609318; PMCID: PMC11029235. ↥
Jongsma, Gayer-Anderson, Lasalvia, Quattrone, Mulè, Szöke, Selten, Turner, Arango, Tarricone, Berardi, Tortelli, Llorca, de Haan, Bobes, Bernardo, Sanjuán, Santos, Arrojo, Del-Ben, Menezes, Velthorst, Murray, Rutten, Jones, van Os, Morgan, Kirkbride; for the European Network of National Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions Work Package 2 (EU-GEI WP2) Group(2018): Treated Incidence of Psychotic Disorders in the Multinational EU-GEI Study. JAMA Psychiatry. 2018;75(1):36–46. doi:10.1001/jamapsychiatry.2017.3554; n = 12,9 Millionen Personenjahre ↥
Gudbrandsdottir RK, Sigurdsson E, Albertsson ÞI, Jonsdottir H, Ingimarsson O (2025): Risk of hospitalisation for first-onset psychosis or mania within a year of ADHD medication initiation in adults with ADHD. BMJ Ment Health. 2025 Apr 12;28(1):e301521. doi: 10.1136/bmjment-2024-301521. PMID: 40221142; PMCID: PMC11997813. ↥
Björkenstam, Pierce, Björkenstam, Dalman, Kosidou (2020): Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and risk for non-affective psychotic disorder: The role of ADHD medication and comorbidity, and sibling comparison. Schizophr Res. 2020 Jan 27;S0920-9964(20)30037-2. doi: 10.1016/j.schres.2020.01.021. PMID: 32001080. n = 548.852 ↥
Hollis, Chen, Chang, Quinn, Viktorin, Lichtenstein, D’Onofrio, Landén, Larsson (2019): Methylphenidate and the risk of psychosis in adolescents and young adults: a population-based cohort study. Lancet Psychiatry. 2019 Aug;6(8):651-658. doi: 10.1016/S2215-0366(19)30189-0. ↥
Pasha K, Paul S, Abbas MS, Nassar ST, Tasha T, Desai A, Bajgain A, Ali A, Dutta C, Elshaikh AO (2023): Psychosis Induced by Methylphenidate in Children and Young Patients With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Cureus. 2023 Jan 28;15(1):e34299. doi: 10.7759/cureus.34299. PMID: 36860219; PMCID: PMC9970721. REVIEW ↥
Ching C, Eslick GD, Poulton AS (2019): Evaluation of Methylphenidate Safety and Maximum-Dose Titration Rationale in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2019 Jul 1;173(7):630-639. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.0905. PMID: 31135892; PMCID: PMC6547117. ↥
Weichmann F, Rohdewald P (2024): Pycnogenol® French maritime pine bark extract in randomized, double-blind, placebo-controlled human clinical studies. Front Nutr. 2024 May 2;11:1389374. doi: 10.3389/fnut.2024.1389374. PMID: 38757130; PMCID: PMC11096518. REVIEW ↥
Socanski D, Ogrim G, Duric N (2024): Children with ADHD and EEG abnormalities at baseline assessment, risk of epileptic seizures and maintenance on methylphenidate three years later. Ann Gen Psychiatry. 2024 Jun 21;23(1):22. doi: 10.1186/s12991-024-00510-4. PMID: 38907242; PMCID: PMC11193234. ↥
Zieglmeier (2014): Methylphenidat bei Erwachsenen. Was ist bei der Therapie zu beachten? Deutsche ApothekerZeitung 44/2014 ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Stahl (2013): Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4. Auflage, Chapter 12: Attention deficit hyperactivity disorder and its treatment, Seite 490 ↥
Kritchman, Koubi, Bloch, Bloch (2019): Effect of Methylphenidate on State Anxiety in Children With ADHD-A Single Dose, Placebo Controlled, Crossover Study. Front Behav Neurosci. 2019 May 15;13:106. doi: 10.3389/fnbeh.2019.00106. eCollection 2019. ↥
Jefsen OH, Østergaard SD, Rohde C. Risk of Mania After Methylphenidate in Patients With Bipolar Disorder. J Clin Psychopharmacol. 2023 Jan-Feb 01;43(1):28-34. doi: 10.1097/JCP.0000000000001631. Epub 2022 Nov 18. PMID: 36584246. n = 1.043 ↥
Horner, Johnson, Schmidt, Rollema (2007): Methylphenidate and atomoxetine increase histamine release in rat prefrontal cortex. Eur J Pharmacol. 2007 Mar 8;558(1-3):96-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2006.11.048. PMID: 17198700. ↥
Mechler, Banaschewski, Hohmann, Häge (2021): Evidence-based pharmacological treatment options for ADHD in children and adolescents. Pharmacol Ther. 2021 Jun 23:107940. doi: 10.1016/j.pharmthera.2021.107940. PMID: 34174276. ↥
Dodson ME, Fryer JM (1980): Postoperative effects of methylphenidate. Br J Anaesth. 1980 Dec;52(12):1265-70. doi: 10.1093/bja/52.12.1265. PMID: 7004471. ↥
Ririe DG, Ririe KL, Sethna NF, Fox L (1997): Unexpected interaction of methylphenidate (Ritalin) with anaesthetic agents. Paediatr Anaesth. 1997;7(1):69-72. doi: 10.1046/j.1460-9592.1997.d01-34.x. PMID: 9041578. ↥
Lowery DP, Wesnes K, Ballard CG (2007): Subtle attentional deficits in the absence of dementia are associated with an increased risk of post-operative delirium. Dement Geriatr Cogn Disord. 2007;23(6):390-4. doi: 10.1159/000101453. PMID: 17396030. ↥
Manso, Morcillo, Pereira, Maldonado (2020): Tricotilomanía de nueva aparición durante el tratamiento con fármacos estimulantes. A propósito de dos casos clínicos pediátricos [New-onset trichotillomania during treatment with stimulant drugs. About two pediatric clinical cases]. Arch Argent Pediatr. 2020 Feb;118(1):e61-e62. Spanish. doi: 10.5546/aap.2020.e61. PMID: 31984712. ↥
Kon, Kon (2020) Severe muscle pain and stiffness due to dexmethylphenidate. Clin Case Rep. 2020 Jan 25;8(3):420-422. doi: 10.1002/ccr3.2628. PMID: 32185027; PMCID: PMC7069845. ↥
Ostdiek-Wille GP, Bavitz KC, Kohn TP, Deibert CM (2023): Attention-deficit hyperactivity disorder medication use is associated with testosterone hypofunction-results from a national claims database analysis. Int J Impot Res. 2023 Dec 21. doi: 10.1038/s41443-023-00805-2. PMID: 38129694. n = 34.448 ↥
Krause, Krause (2014): ADHS im Erwachsenenalter, Seite 262, mit weiteren Nachweisen ↥
Zhang L, Yao H, Li L, Du Rietz E, Andell P, Garcia-Argibay M, D’Onofrio BM, Cortese S, Larsson H, Chang Z (2022): Risk of Cardiovascular Diseases Associated With Medications Used in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022 Nov 1;5(11):e2243597. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.43597. PMID: 36416824; PMCID: PMC9685490. METASTUDIE, n = 3.931.532 in 19 Studien ↥
Peters, Frühgeborene und Schule – Ermutigt oder ausgebremst? Kapitel 2: Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (AD(H)S), Seite 133 ↥
Houghton, de Vries, Loss (2019): Psychostimulants/Atomoxetine and Serious Cardiovascular Events in Children with ADHD or Autism Spectrum Disorder. CNS Drugs. 2019 Nov 25. doi: 10.1007/s40263-019-00686-4. ↥
Liao HC, Hsu CN, Lin FJ, Gau SS, Wang CC (2024): Association between methylphenidate use and long-term cardiovascular risk in paediatric patients with attention deficit and hyperactivity disorder. BMJ Paediatr Open. 2024 Sep 3;8(1):e002753. doi: 10.1136/bmjpo-2024-002753. PMID: 39231572. ↥
Türkmenoğlu, Esedova, Akpınar, Uysal, İrdem (2019): Effects of medications on ventricular repolarization in children with attention deficit hyperactivity disorder. Int Clin Psychopharmacol. 2019 Oct 15. doi: 10.1097/YIC.0000000000000288. ↥
Tanır Y, Erbay MF, Özkan S, Özdemir R, Örengül AC (2023): The Effects of Methylphenidate on Ventricular Repolarization Parameters in Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Alpha Psychiatry. 2023 Sep 1;24(5):174-179. doi: 10.5152/alphapsychiatry.2023.231185. PMID: 38105780; PMCID: PMC10724729. n = 103 ↥
Kılıçaslan F, Tan A, Tanriverdi Z (2025): Evaluation of Frontal QRS-T Angle in Children With ADHD and Healthy Controls. J Atten Disord. 2025 Feb;29(3):165-173. doi: 10.1177/10870547241288353. PMID: 39356495. ↥
Zheng Y, Fukasawa T, Yamaguchi F, Takeuchi M, Kawakami K. Cardiovascular Safety of Atomoxetine and Methylphenidate in Patients With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Japan: A Self-Controlled Case Series Study. J Atten Disord. 2023 Dec 12:10870547231214993. doi: 10.1177/10870547231214993. PMID: 38084080. n ATX = 15.472, n MPH = 12.059 ↥
Harris E. Long-Term ADHD Medications and Cardiovascular Disease Risk. JAMA. 2023 Dec 26;330(24):2331. doi: 10.1001/jama.2023.24173. PMID: 38055293. n = 60.000 ↥
Garcia-Argibay M, Bürkner PC, Lichtenstein P, Zhang L, D’Onofrio BM, Andell P, Chang Z, Cortese S, Larsson H (2024): Methylphenidate and Short-Term Cardiovascular Risk. JAMA Netw Open. 2024 Mar 4;7(3):e241349. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.1349. PMID: 38446477; PMCID: PMC10918505. ↥
Tunca Ç, Güllü İH, Demirtaş İnci S, Kalkan K, Demirkol Tunca R, Efe A, Özkaya Ibiş AN, Taş A, Taha Özkan M, Tanik VO, Ortaköylü O, Özbeyaz NB (2025): Echocardiographic Evaluation of the Effect of Long-Term Methylphenidate Use on Cardiovascular Functions. J Atten Disord. 2025 Mar;29(5):326-335. doi: 10.1177/10870547241307680. PMID: 39754497. n = 121 ↥
Jansen, Hanusch, Pross, Hanff, Drabert, Bollenbach, Dugave, Carmann, Siefen, Emons, Juckel, Legenbauer, Tsikas, Lücke (2020): Enhanced Nitric Oxide (NO) and Decreased ADMA Synthesis in Pediatric ADHD and Selective Potentiation of NO Synthesis by Methylphenidate. J Clin Med. 2020 Jan 8;9(1):E175. doi: 10.3390/jcm9010175. PMID: 31936392. n = 85 ↥ ↥
Fekete, Romanos, Gerlach (2017): Induziert Methylphenidat Leberschäden? – Analyse von Spontanmeldungen an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM); Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000565 ↥
Man KKC, Häge A, Banaschewski T, Inglis SK, Buitelaar J, Carucci S, Danckaerts M, Dittmann RW, Falissard B, Garas P, Hollis C, Konrad K, Kovshoff H, Liddle E, McCarthy S, Neubert A, Nagy P, Rosenthal E, Sonuga-Barke EJS, Zuddas A, Wong ICK, Coghill D; ADDUCE Consortium (2023): Long-term safety of methylphenidate in children and adolescents with ADHD: 2-year outcomes of the Attention Deficit Hyperactivity Disorder Drugs Use Chronic Effects (ADDUCE) study. Lancet Psychiatry. 2023 May;10(5):323-333. doi: 10.1016/S2215-0366(23)00042-1. PMID: 36958362. n = 1.410 ↥
Ørnberg J, Mayer A, Dangel O, Ammer R (2024): Comparison of the real-world safety of two different long-acting methylphenidate formulations (Medikinet® MR and Concerta®) - a Danish nationwide register-based cohort study. Scand J Child Adolesc Psychiatr Psychol. 2024 Nov 16;12(1):84-91. doi: 10.2478/sjcapp-2024-0009. PMID: 39583637; PMCID: PMC11585358. n = 3.704 ↥
Zhang X, Berridge MS, Apana SM, Slikker W Jr, Paule MG, Talpos J (2023): Discontinuation of methylphenidate after long-term exposure in nonhuman primates. Neurotoxicol Teratol. 2023 Mar 7:107173. doi: 10.1016/j.ntt.2023.107173. PMID: 36893929. ↥
Raoofi, Aliaghaei, Abdollahifar, Eskandarian Boroujeni, Sadat Javadinia, Atabati, Abouhamzeh (2019): Long-Term Administration of High-Dose Methylphenidate-Induced Cerebellar Morphology and Function Damage in Adult Rats. J Chem Neuroanat. 2019 Nov 15:101712. doi: 10.1016/j.jchemneu.2019.101712. ↥
da Costa Nunes Gomes, Bellin, da Silva Dias, de Queiroz de Rosa, Araújo, Miraglia, Mendes, Vendramini (2022): Increased sperm DNA damage leads to poor embryo quality and subfertility of male rats treated with methylphenidate hydrochloride in adolescence. Andrology. 2022 Aug 26. doi: 10.1111/andr.13277. PMID: 36029003. ↥
Yochum CL, Medvecky CM, Cheh MA, Bhattacharya P, Wagner GC (2010): Differential development of central dopaminergic and serotonergic systems in BALB/c and C57BL/6J mice. Brain Res. 2010 Aug 19;1349:97-104. doi: 10.1016/j.brainres.2010.06.031. PMID: 20599834. ↥
Rodrigues GAV, Dias FCR, de Oliveira EL, Martins ALP, Matta SLPD (2025): Frequent use of methylphenidate causes reduction in sperm production and sperm quality in adult balb/c mice. Reprod Biol. 2025 Sep;25(3):101043. doi: 10.1016/j.repbio.2025.101043. PMID: 40532595. ↥
Aliakbari F, Hosseini J, Hashemi R, Moamer S, Sadeghzade Z, Rezaei-Tazangi F, Gelehkolee KS, Hamdieh M. Relationship between long-term use of Ritalin and semen parameters in patients referred to psychiatric centres. Andrologia. 2022 Oct 23:e14594. doi: 10.1111/and.14594. PMID: 36274259. n = 100 ↥
Liachenko, Chelonis, Paule, Li M, Sadovova, Talpos (2022): The effects of long-term methylphenidate administration and withdrawal on progressive ratio responding and T2 MRI in the male rhesus monkey. Neurotoxicol Teratol. 2022 Aug 12;93:107119. doi: 10.1016/j.ntt.2022.107119. PMID: 35970252. ↥
Rodriguez, Morris, Hotchkiss, Doerge, Allen, Mattison, Paule (2020): The effects of chronic methylphenidate administration on operant test battery performance in juvenile rhesus monkeys. Neurotoxicol Teratol. 2010 Mar-Apr;32(2):142-51. doi: 10.1016/j.ntt.2009.08.011. PMID: 19737611; PMCID: PMC2942084. ↥
Schermann, Ankory, Shlaifer, Oleg, Rotman, Yoffe, Karakis, Chechik (2018): Lower risk of stress fractures in young adults with ADHD under chronic treatment with methylphenidate. Bone. 2018 Sep 26. pii: S8756-3282(18)30363-6. doi: 10.1016/j.bone.2018.09.023. n = 682.110 ↥
Dong Z, Zhang L, Li L, Liu S, Brikell I, Kuja-Halkola R, D’Onofrio BM, Butwicka A, Gudbjornsdottir S, Larsson H, Chang Z, Du Rietz E (2024): Cumulative ADHD medication use and risk of type 2 diabetes in adults: a Swedish Register study. BMJ Ment Health. 2024 Sep 25;27(1):e301195. doi: 10.1136/bmjment-2024-301195. PMID: 39322586; PMCID: PMC11425947. ↥
Holtzman (1987): Discriminative stimulus effects of caffeine: tolerance and cross-tolerance with methylphenidate. Life Sci. 1987 Jan 26;40(4):381-9. doi: 10.1016/0024-3205(87)90140-8. PMID: 3807640. ↥
Holtzman (1986): Discriminative stimulus properties of caffeine in the rat: noradrenergic mediation. J Pharmacol Exp Ther. 1986 Dec;239(3):706-14. PMID: 2432216. ↥
Finn, Holtzman (1987): Pharmacologic specificity of tolerance to caffeine-induced stimulation of locomotor activity. Psychopharmacology (Berl). 1987;93(4):428-34. doi: 10.1007/BF00207230. PMID: 3124175. ↥
Barkla, McArdle, Newbury-Birch (2015): Are there any potentially dangerous pharmacological effects of combining ADHD medication with alcohol and drugs of abuse? A systematic review of the literature; BMC Psychiatry. 2015 Oct 30;15:270. doi: 10.1186/s12888-015-0657-9. REVIEW ↥
Zhu, Patrick, Straughn, Reeves, Bernstein, Shi, Johnson, Knight, Smith, Malcolm, Markowitz (2917): Ethanol Interactions With Dexmethylphenidate and dl-Methylphenidate Spheroidal Oral Drug Absorption Systems in Healthy Volunteers. J Clin Psychopharmacol. 2017 Aug;37(4):419-428. doi: 10.1097/JCP.0000000000000721. PMID: 28590363; PMCID: PMC5484776. ↥
Empfehlungen der Bundesärztekammer zur Therapie und Versorgung von AD(H)S ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Hahn (2013): Phytopharmaka: Achtung: Interaktionen! Beratung bei pflanzlichen Psychopharmaka. DAZ 2013, Nr. 44, S. 58, 31.10.2013 ↥
Mazhar, Foster, Necyk, Gardiner, Harris, Robaey (2019): Natural Health Product-Drug Interaction Causality Assessment in Pediatric Adverse Event Reports Associated with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Medication. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2019 Oct 31. doi: 10.1089/cap.2019.0102. ↥
Zieglmeier (2014): Methylphenidat bei Erwachsenen. Was ist bei der Therapie zu beachten? Deutsche ApothekerZeitung ↥
red Adulte ADHS: Komedikation bei Methylphenidat. DNP 19, 46 (2018). https://doi.org/10.1007/s15202-018-2101-8 ↥
Schoretsanitis, de Leon, Eap, Kane, Paulzen (2019): Clinically Significant Drug-Drug Interactions with Agents for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. CNS Drugs. 2019 Dec;33(12):1201-1222. doi: 10.1007/s40263-019-00683-7. ↥ ↥ ↥ ↥ ↥ ↥
Moon, Marion, Thanos, Steiner (2021): Fluoxetine Potentiates Oral Methylphenidate-Induced Gene Regulation in the Rat Striatum. Mol Neurobiol. 2021 Jul 2. doi: 10.1007/s12035-021-02466-y. PMID: 34213723. ↥
Hersey M, Bacon AK, Bailey LG, Lee MR, Chen AY, Leggio L, Tanda G (2023): Oxytocin receptors mediate oxytocin potentiation of methylphenidate-induced stimulation of accumbens dopamine in rats. J Neurochem. 2023 Mar;164(5):613-623. doi: 10.1111/jnc.15730. PMID: 36420597. ↥
Markowitz JS, De Faria L, Zhang Q, Melchert PW, Frye RF, Klee BO, Qian Y (2022): The Influence of Cannabidiol on the Pharmacokinetics of Methylphenidate in Healthy Subjects. Med Cannabis Cannabinoids. 2022 Nov 4;5(1):199-206. doi: 10.1159/000527189. PMID: 36467779; PMCID: PMC9710314. ↥
Rose, Hathcock, White, Borowski, Rivera-Chiauzzi (2020): Amphetamine-Dextroamphetamine and Pregnancy: Neonatal Outcomes After Prenatal Prescription Mixed Amphetamine Exposure. J Atten Disord. 2020 Jan 13:1087054719896857. doi: 10.1177/1087054719896857. ↥
Bro, Kjaersgaard, Parner, Sørensen, Olsen, Bech, Pedersen, Christensen, Vestergaard (2015): Adverse pregnancy outcomes after exposure to methylphenidate or atomoxetine during pregnancy. Clin Epidemiol. 2015 Jan 29;7:139-47. doi: 10.2147/CLEP.S72906. eCollection 2015. ↥
Cohen, Hernández-Díaz, Bateman, Park, Desai, Gray, Patorno, Mogun, Huybrechts (2017): Placental Complications Associated With Psychostimulant Use in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017 Dec;130(6):1192-1201. doi: 10.1097/AOG.0000000000002362. ↥ ↥
di Giacomo E, Confalonieri V, Tofani F, Clerici M (2024): Methylphenidate and Atomoxetine in Pregnancy and Possible Adverse Fetal Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Netw Open. 2024 Nov 4;7(11):e2443648. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.43648. Erratum in: JAMA Netw Open. 2025 Apr 1;8(4):e2510141. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.10141. PMID: 39504019; PMCID: PMC11541644. METASTUDY ↥ ↥
Haervig, Mortensen, Hansen, Strandberg-Larsen (2014): Use of ADHD medication during pregnancy from 1999 to 2010: a Danish register-based study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014 May;23(5):526-33. doi: 10.1002/pds.3600. n = 480 unter 1.054.494 Geburten ↥
Pottegård, Hallas, Andersen, Løkkegaard, Dideriksen, Aagaard, Damkier (2014): First-trimester exposure to methylphenidate: a population-based cohort study. J Clin Psychiatry. 2014 Jan;75(1):e88-93. doi: 10.4088/JCP.13m08708. ↥
Szpunar MJ, Freeman MP, Kobylski LA, Rossa ET, Gaccione P, Chitayat D, Viguera AC, Cohen LS (2023): Risk of Major Malformations in Infants After First-Trimester Exposure to Stimulants: Results From the Massachusetts General Hospital National Pregnancy Registry for Psychiatric Medications. J Clin Psychopharmacol. 2023 Jul-Aug 01;43(4):326-332. doi: 10.1097/JCP.0000000000001702. PMID: 37235505. ↥
Koren, Barer, Ornoy (2020): Fetal safety of methylphenidate-A scoping review and meta analysis. Reprod Toxicol. 2020 Apr;93:230-234. doi: 10.1016/j.reprotox.2020.03.003. PMID: 32169555. n = 4 Kohortenstudien mit n = 3.000 Müttern mit und 3.000.000 Müttern ohne MPH-Einnahme während der Schwangerschaft REVIEW ↥
Aoki, Kaizaki-Mitsumoto, Hattori, Numazawa (2021): Fetal methylphenidate exposure induced ADHD-like phenotypes and decreased Drd2 and Slc6a3 expression levels in mouse offspring. Toxicol Lett. 2021 Jun 15;344:1-10. doi: 10.1016/j.toxlet.2021.02.016. PMID: 33647392. ↥
Suarez EA, Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Straub L, McDougle CJ, Wisner KL, Gray KJ, Pennell PB, Lester B, Zhu Y, Mogun H, Huybrechts KF (2024): Prescription Stimulant Use During Pregnancy and Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children. JAMA Psychiatry. 2024 Jan 24:e235073. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2023.5073. PMID: 38265792; PMCID: PMC10809143. n = 4,3 Mio ↥
Bang Madsen K, Larsson H, Skoglund C, Liu X, Munk-Olsen T, Bergink V, Newcorn JH, Cortese S, Lichtenstein P, Kuja-Halkola R, Chang Z, D’Onofrio B, Hove Thomsen P, Klungsøyr K, Brikell I, Garcia-Argibay M (2025): In utero exposure to methylphenidate, amphetamines and atomoxetine and offspring neurodevelopmental disorders - a population-based cohort study and meta-analysis. Mol Psychiatry. 2025 Mar 27. doi: 10.1038/s41380-025-02968-4. PMID: 40148550. ↥
Substanzen mit toxischen pulmonalen Effekten; https://www.msdmanuals.com/ ↥ ↥